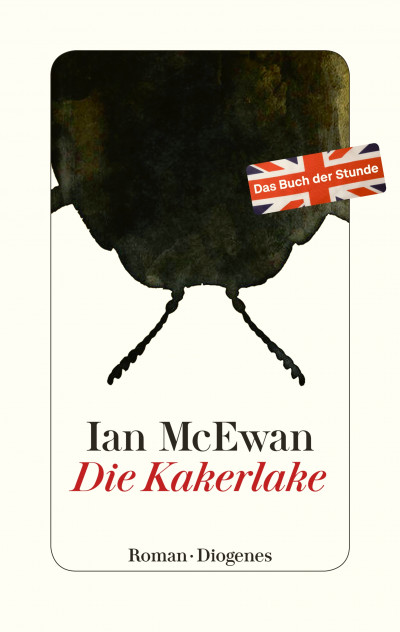John Irvings letzter großer Roman Der letzte Sessellift ist mehr als ein umfangreiches Familiendrama – es ist ein literarisches Monument über die Geschichte queerer Identität, die Suche nach Herkunft, und die tiefe emotionale Verfasstheit von Menschen, die sich außerhalb gesellschaftlicher Normen bewegen. Mit großer erzählerischer Kraft verschränkt Irving Biografie, Geistergeschichte und politische Zeitdiagnose zu einem Werk, das zugleich intim und epochal wirkt.
John Irving „Der letzte Sessellift“ – Queeres Leben, Geister der Vergangenheit und Amerikas verdrängte Wahrheiten
Die queere Familie als literarisches Zentrum
Im Zentrum steht Adam Brewster, der Sohn der Skifahrerin Rachel Brewster. Rachel wird 1941 während eines Skirennens in Aspen schwanger – vom Vater erfährt Adam nur, dass er ein namenloser Samenspender war, der keinerlei Rolle im Leben des Kindes spielen sollte. Rachel sieht ihren Sohn als Lebensprojekt, nicht als Konsequenz romantischer Liebe. Die beiden bleiben ein Leben lang auf erschütternd enge Weise verbunden – bis ins Erwachsenenalter teilen sie ein Bett, fast wie zwei Seelen in einem Körper. Diese radikale Nähe überschreitet konventionelle familiäre Grenzen, wird aber von Irving nicht moralisch gewertet, sondern als Ausdruck bedingungsloser Bindung gezeichnet.
Rachels Lebensentwurf ist offen lesbisch. Sie lebt mit Molly zusammen, später heiratet sie den Transmann Elliot Barlow, der ebenfalls Teil der queeren Familie wird. Adams Umfeld ist von queeren Identitäten durchdrungen – nicht als Ausnahme, sondern als Selbstverständlichkeit. In einer Zeit, in der LGBTQ+-Rechte in den USA noch massiv unter Druck stehen – insbesondere während der konservativen Reagan-Ära –, markiert diese familiäre Konstellation einen Akt des Widerstands.
Zwischen Reagan-Ära und Stonewall-Erbe: Queere Identität im politischen Kontext
Irving bettet das Leben seiner Figuren in die gesellschaftliche und politische Realität der USA ein. Die 1980er-Jahre sind geprägt von einer Rückkehr zu konservativen Werten, während zugleich die queere Bewegung seit Stonewall (1969) um Anerkennung, Schutz und Gleichberechtigung kämpft. Adam wächst mit einem Bewusstsein für diese Spannungen auf. Seine Familie lebt das, wofür andere noch auf die Straße gehen müssen – und zahlt dafür emotional einen Preis.
Der Roman reflektiert so auch die Entwicklung der LGBTQ+-Bewegung in den USA – von der Unsichtbarkeit zur Sichtbarkeit, vom Schweigen zur Forderung nach Rechten. Irving erzählt nicht direkt von Stonewall oder AIDS, aber sein Roman ist durchzogen von der gesellschaftlichen Repression, dem moralischen Druck und der Unsicherheit, mit der queeres Leben jahrzehntelang verbunden war.
Die Geister von Aspen: Spurensuche in der Vergangenheit
Ein weiterer Erzählstrang ist Adams lebenslange Suche nach seinem leiblichen Vater. Diese führt ihn immer wieder nach Aspen, wo Rachel einst das Skirennen bestritt und Adam gezeugt wurde. Aspen ist in diesem Roman nicht nur ein Ort, sondern ein mythischer Raum – eine Bühne, auf der sich Vergangenheit, Illusion und Realität überlagern.
In einem abgelegenen Hotel begegnet Adam immer wieder einer gespenstischen Erscheinung – einer Frau im grünen Pullover, die schweigend und unbewegt in den Korridoren auftaucht. Irving nutzt das Motiv des Gespensts nicht als Horror-Element, sondern als poetisches Symbol für verdrängte Wahrheiten. Diese Geister sind Projektionen von Schuld, Sehnsucht und Erinnerung – Spiegel der emotionalen Geister, die seine Figuren begleiten.
Wiederholungsmuster und emotionale Reproduktionen
Nach dem tragischen Tod seiner Cousine Nora – sie stirbt bei einem Amoklauf in einem Comedy-Club – entwickelt Adam eine enge Beziehung zu deren Partnerin. Diese Beziehung ist mehr als Trost – sie ist eine Wiederholung, fast eine Fortsetzung seiner Verbindung zur Mutter. Adam sucht Nähe, Verschmelzung, eine Form emotionaler Symbiose, die außerhalb klassischer Beziehungsmuster liegt.
Irving zeichnet hier kein pathologisches Bild, sondern fragt grundlegend: Was bedeutet emotionale Zugehörigkeit? Wer definiert Familie? Welche Formen der Liebe dürfen bestehen, wenn gesellschaftliche Normen versagen?
Stil, Struktur und das literarische Vermächtnis Irvings
Der letzte Sessellift ist ein vielstimmiges, experimentierfreudiges Werk. Teilweise als Filmskript geschrieben, reflektiert es Adams Beruf als Drehbuchautor – und bricht bewusst mit klassischen Erzählkonventionen. Die Sprache ist detailreich, stellenweise überbordend, stets aber getragen von Empathie und einem tiefen Interesse an menschlicher Komplexität.
Kritiker haben die Länge des Romans als ermüdend beschrieben – doch gerade diese narrative Ausdehnung erlaubt es Irving, seine Themen mit epischer Tiefe zu entwickeln. Die Tragikomik, das Spiel mit Identitäten, die erzählerische Geduld – all dies macht Der letzte Sessellift zu einem Roman, der nicht nur gelesen, sondern durchlebt werden will.
Ein Roman wie ein Lebenspanorama
Mit Der letzte Sessellift hat John Irving einen Roman vorgelegt, der in seiner emotionalen Tiefe, politischen Einbettung und erzählerischen Kraft das queere Amerika in all seiner Zerrissenheit und Schönheit sichtbar macht. Es ist ein Buch über das, was nicht in gesellschaftliche Raster passt – über Geister, die uns nicht loslassen, und über Familien, die sich jenseits von Blutsverwandtschaft konstituieren.
Ein Vermächtnis – literarisch, politisch, menschlich.
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Straße der Wunder
Elefant von Martin Suter: Genetik, Konflikt & die Ethik eines leuchtenden Wunders
„Wut und Liebe“ von Martin Suter – Warum dieser Roman das Beziehungsdrama unserer Zeit trifft
Melody - ein Martin Suter Roman von Liebe und Verlust
Fabulieren und ausschlachten: 80 Jahre John Irving
Lila, Lila - ein Liebesroman von Martin Suter
Der grimmige Geist
Das Geheimnis eines Kindes
Benedict Wells - "Hard Land": Zum Beispiel letztes Jahr im Sommer
Ian McEwan: Wie eine Kakerlake zum Regierungschef wird
Daniele Krien auf Platz 1 der Bestsellerliste im Juli - Ein Blick ins Buch
Wie menschlich ist die K.I.
John Irving wird heute 75 Jahre alt
Aktuelles
Der Sohn des Wolfs – Jack Londons frühe Alaska-Erzählungen
Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher
Wolfsblut – Der Weg aus der Wildnis

Manfred Rath :In den Lüften
Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts
PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg
Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See
Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie
Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Rezensionen
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle