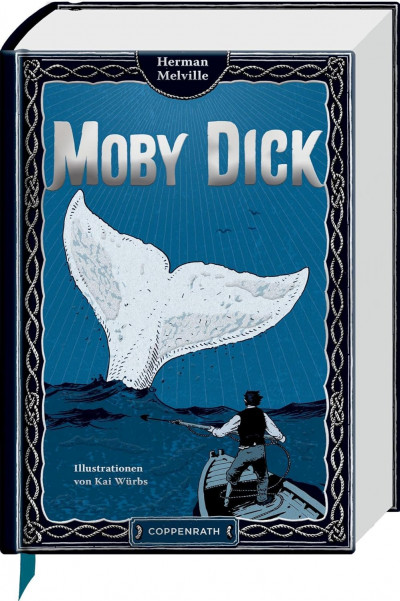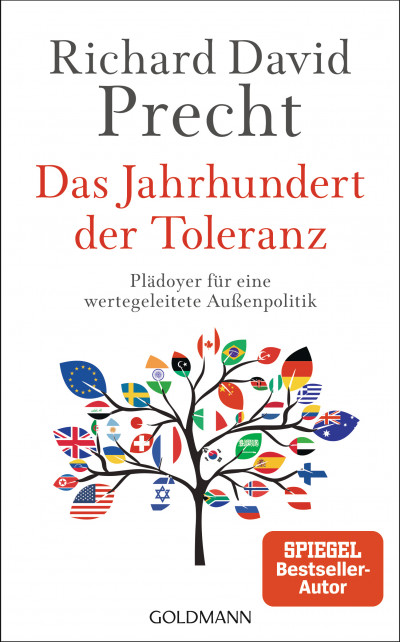Sally Rooney, erschienen 2018 bei Faber & Faber, deutsche Ausgabe am 17. August 2020 bei Luchterhand, übersetzt von Zoë Beck.
Zwei Menschen, ein Ort, eine Verbindung: Connell und Marianne kennen einander aus der westirischen Kleinstadt Carricklea. Viel verbindet sie nicht – außer einer merkwürdigen Vertrautheit, die weder zeitgemäß noch stabil wirkt, dafür umso tiefer greift. Rooney erzählt eine Beziehungsgeschichte – aber ohne Beziehungsroman zu sein, und schon gar nicht ohne Happy End – oder dem, was man darunter gemeinhin versteht.
Wenn Nähe nicht einfach Nähe ist
In der Schule ist Connell beliebt, Marianne ignoriert. Er der Fußballspieler, sie die intellektuelle Einzelgängerin mit sturer Miene. Doch als Connells Mutter als Haushaltshilfe bei Mariannes Familie arbeitet, treffen die beiden außerhalb der sozialen Bühne aufeinander – und was folgt, ist keine klassische Annäherung, sondern ein allmähliches Einverleiben.
Rooney beginnt stark, mit dem präzisen Blick auf die Außenwelt: Schule, Status, schweigende Elternhäuser. Dann, am Trinity College in Dublin, verschieben sich die Rollen. Plötzlich ist es Marianne, die sich mühelos bewegt, während Connell zwischen Einsamkeit und ökonomischem Druck taumelt. Ihre Beziehung bleibt ein unsteter Fluss – durchzogen von Abhängigkeit, Zurückweisung, Bedürftigkeit, aber auch Zärtlichkeit. Sie verletzen einander – nicht aus Bosheit, sondern aus Unfähigkeit zur Offenheit.
Kein Satz zu viel – und kein Klischee
Rooneys Sprache ist unaufgeregt, beinahe kühl, doch immer präzise. Was nicht gesagt wird, wirkt hier oft stärker als das Gesagte. Die wörtliche Rede ist nicht durch Anführungszeichen markiert, ein stilistischer Verzicht, der Nähe suggeriert – oder zumindest die Illusion davon. Es ist ein ruhiger, klarer Ton, der dennoch unter der Oberfläche gärt. Die Körperlichkeit, die Intimität – all das wird gezeigt, aber nie ausgestellt.
Rooney interessiert sich nicht für große Gesten. Ihre Figuren sind keine Helden, sondern Konstrukte aus Unsicherheit, Schweigen, Scham. Das psychologische Porträt bleibt dabei erschütternd genau. Sie seziert, was oft übersehen wird: Wie Sprache versagt, wie Herkunft wirkt, wie das Schweigen in einer Beziehung lauter sein kann als jedes Wort.
Marianne kämpft nicht nur mit familiärer Gewalt, sondern auch mit Selbstwertverlust, der sich subtil in ihren Liebesbeziehungen fortschreibt. Connell wiederum leidet unter der Unsichtbarkeit seiner eigenen emotionalen Bedürfnisse – besonders dann, wenn sie nicht in die männliche Rolle passen, die sein Umfeld ihm zuschreibt.
Kritik an der Oberfläche?
Einige Leser werfen Rooney vor, dass sie sich in einer Form emotionaler Zurückhaltung einrichtet, die auf Dauer formelhaft wirke. Die Figuren wirken nie überlebensgroß, manchmal sogar erstaunlich klein – doch gerade diese menschliche Kleinheit ist es, die „Normale Menschen“ so bestechend macht. Wer große Dramen sucht, wird enttäuscht – wer aber aufmerksam liest, entdeckt ein feines Spiel zwischen sozialer Zugehörigkeit und individueller Verletzlichkeit.
Die psychologischen Wiederholungen – Connell redet nicht, Marianne zieht sich zurück – könnten monoton wirken, doch sie spiegeln lediglich das, was sie sind: wiederkehrende Muster, aus denen diese beiden Menschen nicht ausbrechen können. Auch das ist eine Wahrheit, die selten erzählt wird: Dass Erkenntnis nicht immer Veränderung nach sich zieht.
Literatur, die nicht aufrührt aber berührt
Rooney entwirft keine moralischen Leitbilder, sie schont ihre Figuren nicht, aber sie urteilt auch nicht über sie. Vielleicht ist das ihr größter Kunstgriff: Diese Geschichte könnte trivial sein, wäre sie nicht so radikal präzise erzählt. Es ist keine Geschichte von Erlösung, sondern von Beharrlichkeit. Zwei Menschen, die nicht zusammengehören – und trotzdem nicht voneinander lassen können.
Verfilmung: Nähe durch Blick
Die BBC/Hulu-Verfilmung von 2020 (Regie: Lenny Abrahamson, Hettie Macdonald) gelingt das fast Unmögliche: Sie überträgt Rooneys Intimität und dialogische Kargheit in ein visuelles Format, ohne deren Tiefe zu verlieren. Daisy Edgar-Jones (als Marianne) und Paul Mescal (als Connell) spielen so zurückhaltend wie intensiv – Blicke, Pausen, leise Körpersprache ersetzen das Innenleben der Romanvorlage fast mühelos. Es ist eine der seltenen Adaptionen, die dem Buch nicht nur gerecht werden, sondern es neu erfahrbar machen.
Ein paar inhaltliche Abschwächungen – etwa bei der familiären Gewalt – trüben den Gesamteindruck nicht. Was bleibt, ist eine sensible Studie über Nähe, Macht, Abhängigkeit. Keine Serie für nebenbei, aber eine, die in Erinnerung bleibt. Fast so wie das Buch.
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Moby-Dick – Melvilles grandioser Kampf zwischen Mensch und Mythos
The Girl on the Train von Paula Hawkins – Psychothriller voller Ungewissheit und Obsession
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Der Leopard – Der Untergang einer Welt
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Warum „Vergissmeinnicht – Was die Welt zusammenhält“ von Kerstin Gier das Fantasy-Highlight des Jahres ist
Atlas: Die Geschichte von Pa Salt – Der finale Band der „Sieben Schwestern“-Saga enthüllt das lang gehütete Geheimnis
Clemens Meyer liefert literarisches Meisterwerk: "Die Projektoren"
Schach dem König. Friedrich der Große und Albert von Hoditz. Eine ungewöhnliche Freundschaft
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Amor Towles: Ein Gentleman in Moskau
Momo - ein zeitlose Botschaft
Doktor Garin
*DIESER BEITRAG WURDE ENTFERNT* von Hanna Bervoets
Weck nicht den Panda!
Das Leben ist zu kurz für irgendwann - ein Roadtrip mit Tiefgang
Aktuelles
Der Sohn des Wolfs – Jack Londons frühe Alaska-Erzählungen
Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher
Wolfsblut – Der Weg aus der Wildnis

Manfred Rath :In den Lüften
Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts
PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg
Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See
Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie
Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Rezensionen
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle