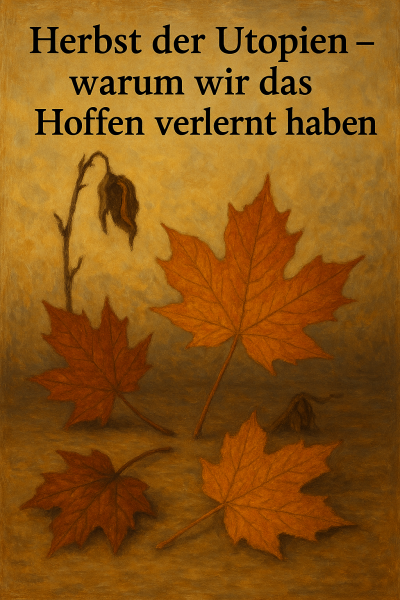Manchmal reicht ein Blick aufs Konto, und die Realität liest sich wie ein schlechter Roman. Doch genau daraus machen Schriftsteller seit über hundert Jahren Literatur: das Ringen mit Geld, mit Jobverlust, mit der Frage, wie man überlebt, wenn man eigentlich schon gefallen ist.
Hans Fallada beschrieb in den 1930er-Jahren die kleinen Leute, die in der Krise taumeln. Heute tun es Autorinnen und Autoren von New York bis Berlin – weil das Leben in prekären Verhältnissen wieder zum Alltag gehört.
Fallada: Der Roman der kleinen Leute
Hans Falladas Kleiner Mann – was nun? (1932) gilt als Schlüsselroman der Weltwirtschaftskrise. Er erzählt von Pinneberg, einem schüchternen Angestellten, der um seine Anstellung bangt, und seiner Frau Lämmchen. Keine großen Helden, keine Weltgeschichte – nur die ständige Angst, den Job zu verlieren.
Fallada hat damit das geschrieben, was man heute „Prekaritätsliteratur“ nennen würde: Geschichten, in denen wirtschaftliche Unsicherheit nicht Hintergrund, sondern Hauptfigur ist.
Die Gegenwart: Prekariat 2.0
Fast ein Jahrhundert später klingt vieles vertraut. Befristete Jobs, Freelance-Arbeit, Plattform-Ökonomie – die Sicherheit des „Lebensplans“ ist brüchig geworden. Autorinnen wie Annie Ernaux (die in ihren Tagebuchprosa immer wieder ökonomische Abhängigkeiten sichtbar macht), Michel Houellebecq (mit seinen müden Angestellten und resignierten Akademikern) oder deutsche Stimmen wie Leif Randt und Dana Vowinckel zeigen Figuren, deren Lebensläufe von Unsicherheit geprägt sind.
Statt der „Weltwirtschaftskrise“ heißt es heute: Finanzkrise, Inflation, Mietexplosion. Doch das Gefühl bleibt dasselbe: Man lebt auf Kante, jederzeit kann ein kleiner Auslöser reichen, um ins Leere zu stürzen.
Warum Literatur das so gut kann
Wirtschaftliche Krisen erscheinen in Statistiken und Schlagzeilen abstrakt. Literatur aber übersetzt sie ins Konkrete. Sie zeigt, wie Angst vor Entlassung die Ehe verändert, wie Armut Freundschaften zerstört, wie Unsicherheit den Alltag vergiftet.
Schon Fallada wusste: Das Politische wirkt nicht abstrakt, sondern im Wohnzimmer, am Küchentisch, beim Blick auf die Lohntüte. Genau das greifen heutige Autorinnen wieder auf.
Prekarität als Narrativ unserer Zeit
Dass Prekarität zurückkehrt, ist kein Zufall. Nach der Finanzkrise 2008 entstanden Romane, die nicht mehr den großen Aufstieg oder die „Generation Yuppie“ feierten, sondern Unsicherheit erzählten. Auch im deutschsprachigen Raum: Romane über junge Akademiker ohne Jobgarantie, über das Leben zwischen Befristung und Burnout, über das Warten auf den nächsten Vertrag.
Die Parallelen zur Weimarer Zeit sind unübersehbar. Damals wie heute reagiert Literatur auf eine Der kleine Mann bleibt aktuell
Die Finanzkrise ist kein abgeschlossenes Kapitel, sie hallt bis heute nach – in steigenden Mieten, in unsicheren Arbeitsverhältnissen, in der wachsenden Ungleichheit. Dass die Literatur darauf reagiert, ist kein nostalgisches Zitat bei Fallada, sondern eine Notwendigkeit.
Denn solange Prekarität zum Lebensgefühl einer Generation wird, bleibt sie ein Thema für Romane. Der kleine Mann – und die kleine Frau – sind nicht verschwunden. Sie kämpfen heute nur nicht mehr mit Lohntüten, sondern mit digitalen Jobplattformen.
Über die Autoren
Hans Fallada (1893–1947) gilt als Chronist der Weimarer Republik und des „kleinen Mannes“. Mit Kleiner Mann – was nun? schrieb er den großen Krisenroman seiner Zeit. In der Gegenwart führen zahlreiche Autorinnen und Autoren diese Tradition fort, von Annie Ernaux über Michel Houellebecq bis zu jüngeren deutschen Stimmen, die das fragile Leben im 21. Jahrhundert beschreiben.
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Stille Nacht, laute Welt – warum uns das Friedensmotiv in der Literatur nicht tröstet
Die vergessene Moderne – Hermynia Zur Mühlen und die Kunst des Widerspruchs
Herbst der Utopien – warum wir das Hoffen verlernt haben
Die andere Moderne: Irmgard Keun und die Frauenstimmen der 1930er
Mein Bücherregal entrümpeln – Eine literarische Reise durch 100 Jahre Deutschland
Aktuelles
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Tausende Stimmen für das Lesen: Weltrekordversuch in der MEWA Arena Mainz
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
Nachdenken einer vernachlässigten Sache
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Horaffe: Ein Land
Karen W. – Eine Resonanz des Alltags
Über Tatsuzō Ishikawas „Die letzte Utopie“
Jack London lesen: Vier Bücher und der Ursprung eines amerikanischen Erzählens

Manfred Rath: Der letzte Morgen des Universums
Zum Tod von Erich von Däniken (1935–2026)
Die Geduld der Zukunft – warum das Warten die unterschätzte Tugend unserer Zeit ist
Rezensionen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle