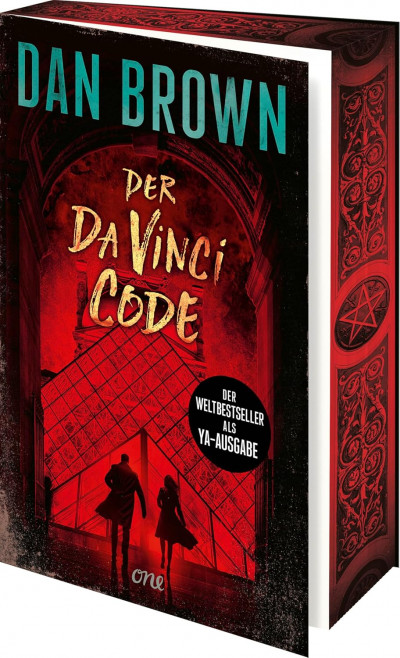Dan Brown ist zurück – und das mit allem, was dazugehört: einem alten Manuskript, einer verschwundenen Wissenschaftlerin, einem Harvard-Professor mit Vorliebe für Codes und einer Prise Quantenspekulation, gewürzt mit einem Schuss Esoterik. The Secret of Secrets heißt sein neuester Roman – oder, wie die Welt es nennt, ein „weltanschaulicher Traktat in Romanverkleidung“. Und ja, das ist polemisch gemeint.
Zwischen Golem und Gehirnmythen: Wie die Welt Dan Browns neues Buch seziert – und dabei vergisst, worum es eigentlich geht
Die Welt hat sich Browns neuesten Streich gründlich vorgenommen und listet, in bewährter Systematik, elf „Falschmeldungen“ auf, mit denen Brown angeblich seine Leser narrt. Die Spannbreite reicht von der Behauptung, Noetik sei eine ernstzunehmende Wissenschaft, über die Vorstellung, das menschliche Gehirn sei zu klein für seine Leistungen, bis hin zu der Szene, in der in Prag jemand nachts als Golem verkleidet durch die Straßen läuft – was laut Welt „nicht normal“ sei. Man fühlt sich beim Lesen der Kritik bald wie im Faktencheck einer populärwissenschaftlichen Sendung, in der ein Roman zum Versuchsobjekt stilisiert wird.
Dabei schwankt die Tonlage zwischen faktengetreuer Richtigstellung und belehrendem Furor: Der Kritiker rechnet nicht mit Dan Brown als Erzähler, sondern mit Dan Brown als vermeintlichem Aufklärungsgegner, als Mystiker, der das Publikum gezielt desinformiert. Zwischen Hirnforschung, Quantentheorie und mittelalterlicher Agrartechnik wird aufgeräumt, korrigiert, geradegerückt – mit einer Ernsthaftigkeit, die fast an Rechthaberei grenzt. Man liest die Kritik und fragt sich irgendwann: Geht es hier noch um Literatur oder schon um den naturwissenschaftlichen Wahrheitsgehalt von Fiktionen? Die Figuren Browns werden wie fehlerhafte Quellen behandelt, seine Erzählwelt wie ein misslungenes Sachbuch.
Was dabei verloren geht, ist der literarische Kontext – also das Bewusstsein dafür, dass Brown nicht belehren will, sondern unterhalten. Und dass seine Mittel dabei stets plakativ, manchmal plump, aber selten ohne dramaturgisches Kalkül sind.
Die Brown-Formel: Wiederholung als Methode
Dabei wirkt die Kritik in ihrer Empörung fast ein wenig gekünstelt. Denn Brown liefert, was Brown eben liefert – und das seit über zwanzig Jahren. Wer bei Seite 17 überrascht feststellt, dass es auch diesmal um alte Symbole, neue Wissenschaft und moralisch fragwürdige Gegenfiguren geht, hat womöglich die vorherigen fünf Langdon-Romane nicht ganz aufmerksam gelesen.
Die Formel ist bekannt: Historisches Halbwissen trifft auf spekulative Theorie, gewürzt mit akademischem Jargon und theatralisch aufgeladenen Dialogen. Dass sich Browns Weltbild dabei nie ganz von der Oberfläche entfernt, ist kein Mangel, sondern Bestandteil seines literarischen Ökosystems.
Man könnte fast sagen: Dan Brown schreibt seit Jahren am selben Buch weiter. Nur die Kulisse wechselt, die Codes werden komplizierter, und seine Figuren altern mit – genau wie ihre Überzeugungen. Wenn Katherine Solomon heute noch über Noetik doziert, klingt das nicht deshalb befremdlich, weil es falsch wäre, sondern weil wir inzwischen besser wissen, wie fragil solche Konzepte wissenschaftlich gesehen sind.
Brown hingegen gibt sich keine Mühe, das zu verbergen – im Gegenteil: Er inszeniert die spekulative Grenzwissenschaft geradezu mit Lust. Er+ will, dass wir glauben wollen, was seine Figuren verkünden. Dass er dabei Realität und Fiktion munter vermengt, ist kein Irrtum, sondern Kalkül.
Kritik, die das Spiel nicht mitspielen will
Die Welt dagegen nimmt Brown beim Wort – und damit auch viel zu ernst. Wenn dort referiert wird, wie viele Milliarden Neuronen das menschliche Gehirn tatsächlich hat, um eine Romanzeile zu widerlegen, dann übersieht man vielleicht, dass The Secret of Secrets kein Beitrag zur Neurowissenschaft sein will. Ebenso wenig wie Der Da Vinci Code eine kirchengeschichtliche Dissertation war.
Natürlich sind Browns Bücher oft naiv – was historische Genauigkeit angeht, manchmal auch, was moralische Einordnungen betrifft. Aber wer sich darüber erstaunt zeigt, dass Brown das Mittelalter ein wenig schwärzer malt, als es war, oder dass er Nahtoderfahrungen für Beweise einer jenseitigen Existenz hält, der verwechselt den Roman mit einem Lexikon.
Die Kritik liest Brown mit dem Skalpell – präzise, aber ohne Gespür für die Mechanik seiner Erzählung. Die Kritik liest Brown mit dem Skalpell – präzise, aber ohne Gespür für die Mechanik seiner Erzählung. Seine Figuren wirken wie aufziehbare Spiralmenschen, sein Stil erinnert in manchen Passagen an einen Wikipedia-Ausdruck, die Dialoge bleiben oft auf dem Niveau literarischer Gebrauchstexte. Das mag man kritisieren – doch es war nie anders. Brown schreibt nicht subtil, sondern effektiv. Nicht originell, sondern massenwirksam. Nicht tiefgründig, sondern tief greifend. Nicht tiefgründig, sondern tief greifend.
Brown als Zeitkommentator? Warum nicht.
Interessanter als die Frage, ob Noetik eine Wissenschaft ist, wäre vielleicht jene: Warum greifen solche Ideen heute wieder? Warum suchen Leser in einer zunehmend von Fakten zersetzten Welt gerade bei Brown nach Orientierung?
„The Secret of Secrets“ nimmt die großen Fragen der Gegenwart auf – Identität, Bewusstsein, Spiritualität, Kontrolle – und verpackt sie in die Sprache des Thrillers. Dass dabei keine wissenschaftlich belastbaren Antworten herauskommen, ist kaum verwunderlich. Dass die Fragen überhaupt gestellt werden, schon eher.
Insofern lässt sich in Brown durchaus ein Schriftsteller beim Altern beobachten: Seine Bücher werden wortreicher, seine Thesen verschwommener, sein Misstrauen gegenüber rationaler Weltdeutung größer. Wo er früher den Klerus attackierte, stellt er nun die Wissenschaft infrage. Und das nicht aus Bosheit, sondern aus Weltüberdruss.
Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft seines neuesten Romans: Die Komplexität der Welt ist so überwältigend geworden, dass selbst ein Langdon nur noch metaphorisch entschlüsseln kann. Und wenn wir dafür einen Golem brauchen, der durch Prag stolpert – sei's drum.
Kein Skandal, sondern ein Spiegel
Dan Browns The Secret of Secrets ist kein großer Wurf, aber auch kein Desaster. Es ist ein Roman, der tut, was seine Vorgänger auch getan haben: unterhalten, aufrühren, spekulieren – und dabei immer ein bisschen übertreiben.
Die Welt mag recht haben mit ihrer Liste. Aber vielleicht schaut sie einfach zu direkt hin. Manchmal hilft es, einen Schritt zurückzutreten – und zu erkennen, dass Dan Brown weniger Weltdeuter als Weltenbauer ist. Und dass seine Romane uns nicht die Wahrheit sagen wollen, sondern unsere Lust an ihr ausloten.
Hier gehts zum Artikel : Die elf Falschmeldungen des Dan Brown auf Welt
Hier bestellen
Topnews
Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
Zwischen Logik und Legende: Netflix adaptiert Dan Browns „The Secret of Secrets“
Markus Ostermair punktet mit Debütroman "Der Sandler"
E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ als unruhige Studie über Wahrnehmung
Meistverkauften Bestseller 2025
Zwei Listen, zwei Realitäten: Was Bestseller über das Lesen erzählen
Percival Everett – Dr. No
Der Da Vinci Code von Dan Brown – Schnitzeljagd durch Museen, Mythen und Macht
Druckfrisch vom 12. Oktober 2025 László Krasznahorkai, Anja Kampmann, Katerina Poladjan – und Denis Scheck mit der SPIEGEL-Bestsellerliste
Denis Scheck in Druckfrisch (14.09.2025): Kafka, Ian McEwan und 20.000 Elefanten
Denis Scheck über die Spiegel-Sachbuch-Bestseller: Zwischen Epos und lahmer Ente
Amazon-Rezensionen: Die FAZ über Caroline Wahls „Die Assistentin“
Peter Huth – Aufsteiger
Denis Schecks sanfter Sommer – Die Bestsellerliste unter der Lupe
Origin – Die größte Verschwörung um Glaube und Wissenschaft von Dan Brown
Die Harry Potter-Reihe von J. K. Rowling – Sieben Bände, ein literarisches Kontinuum
Aktuelles
Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend
The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst
Leipzig liest: Von Alltäglichkeiten, Umbrüchen und der Arbeit am Erzählen
Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage
Nicolas Mahler erhält 2026 Wilhelm-Busch-Preis und e.o.plauen-Preis
Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit