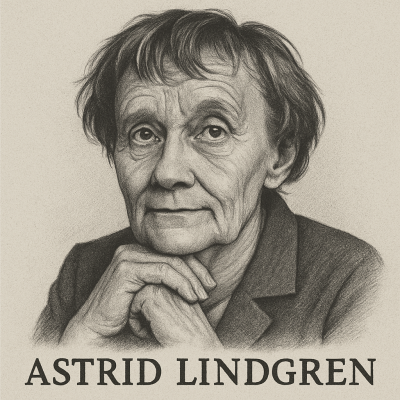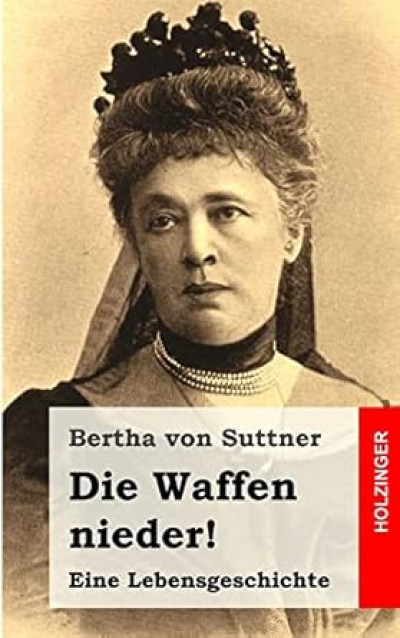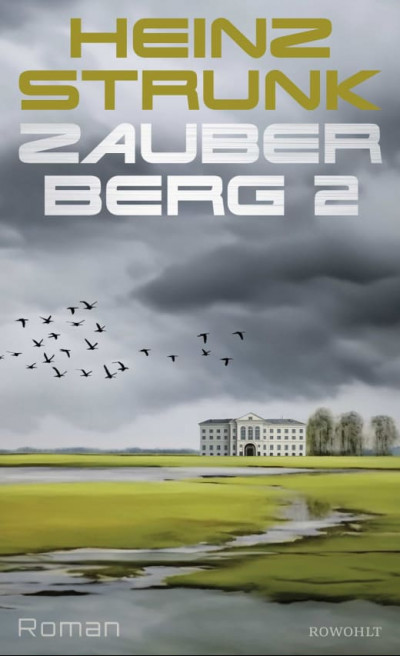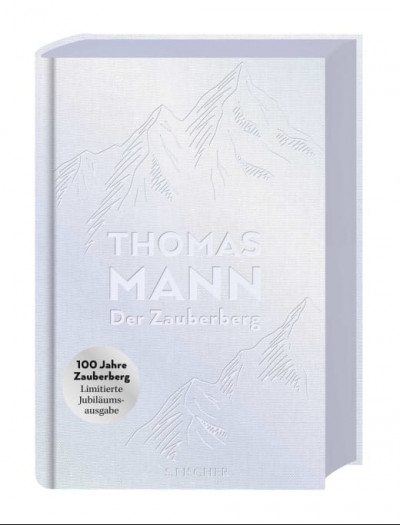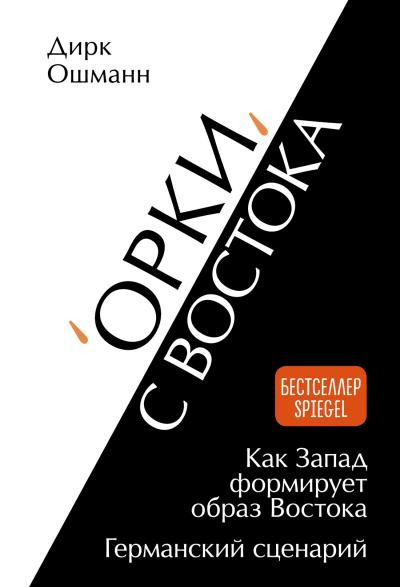Es ist der dritte Tag des neuen Jahres. Der Baum nadelt, die Vorsätze sind noch frisch, und irgendwo zwischen Kalenderblatt und Kaffeeduft steht die stille Frage: Wird es diesmal anders?
Doch Hoffnung hat selten etwas mit Anfang zu tun. Sie ist kein Feuerwerk, sondern ein Echo. Eine Bewegung, die aus der Erinnerung kommt, nicht aus dem Enthusiasmus. Hoffnung ist das, was bleibt, wenn das Alte noch nachhallt und das Neue noch nicht spricht.
Der Januar als Schleife
Jedes Jahr beginnt gleich: Vorsätze, Fitnessprogramme, Aufräumaktionen, ein bisschen Weltschmerz. Wir tun so, als ließe sich das Leben resetten, dabei wissen wir längst, dass alles eine Wiederholung ist. Vielleicht ist genau das der Trost: dass es immer weitergeht, auch ohne Erlösung.
Friedrich Hölderlin hat diesen paradoxen Zustand in eine Zeile gefasst, die bis heute standhält, weil sie nichts verspricht:
„Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.“
Das ist der Ton des Januars – kein Triumph, kein Pathos, sondern die nüchterne Einsicht, dass Gegensätze sich nicht aufheben, sondern ineinander wohnen.
Erinnerung als Treibstoff
Hoffnung ist kein Ausweg aus der Vergangenheit, sondern ihre Fortsetzung. Paul Celan, dessen Schreiben aus Verlust und Bruch hervorgeht, notierte den Satz:
„Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt.“
Hoffnung erscheint hier nicht als Gefühl, sondern als Zumutung. Etwas soll sich verändern, obwohl alles dagegen spricht. Nicht aus Optimismus, sondern aus Notwendigkeit.
Auch Samuel Beckett wusste, dass Hoffnung nichts Glänzendes ist. In Worstward Ho schreibt er:
„Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.“
Das ist kein Trost im klassischen Sinn. Es ist eine Haltung. Hoffnung als Bewegung im Scheitern, nicht als Ausweg aus ihm. Kein Vielleicht, sondern ein Trotzdem.
Die kurze Nacht, das lange Licht
Die längsten Nächte liegen hinter uns, und doch ist es noch dunkel. Aber die Erde hat sich bereits entschieden: Sie wendet sich dem Licht zu. Vielleicht ist das die eigentliche Hoffnung – nicht das Versprechen, sondern die Bewegung.
Emily Dickinson hat dieses Prinzip in eine der bekanntesten Metaphern der Moderne übersetzt:
„Hope is the thing with feathers / That perches in the soul.“
Hoffnung sitzt nicht am Horizont, sondern im Inneren. Sie singt, schreibt Dickinson, selbst im Sturm. Nicht laut, aber beharrlich.
Clarice Lispector hätte diese Vorstellung verstanden. Für sie lag Hoffnung nicht im Ergebnis, sondern im Bewusstsein – in jenem Moment, in dem man bemerkt, dass die Welt weiter atmet, auch wenn man selbst innehält.
Hoffnung als Haltung
Ingeborg Bachmann schrieb den Satz:
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“
Das gilt auch für Hoffnung. Sie ist keine Flucht, kein Zuckerüberzug, sondern eine Form der Klarheit. Sie hält aus, dass Wiederholung kein Versagen ist und Stillstand keine Option.
Vielleicht muss man Hoffnung also neu denken: nicht als Ziel, sondern als Methode. Als Aufmerksamkeit für das, was bleibt, wenn man alles verloren glaubt. Als Fähigkeit, im Unfertigen zu verweilen, ohne es zu verklären.
Nach dem Licht
Hoffnung ist das, was man tut, nicht das, woran man glaubt. Sie steckt in der Entscheidung, weiterzulesen, weiterzuschreiben, weiterzuleben – obwohl man weiß, dass sich vieles wiederholen wird.
Die längsten Nächte sind vorbei.
Das Licht kommt langsam zurück.
Topnews
Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
Die Geduld der Zukunft – warum das Warten die unterschätzte Tugend unserer Zeit ist
Stille Nacht, laute Welt – warum uns das Friedensmotiv in der Literatur nicht tröstet
Nach dem Lärm – Fastenzeit als Übung des Geistes
Die langsame Gnade – wie Literatur durch den Winter trägt
Kafka am Strand von Haruki Murakami
Karen W. – Eine Resonanz des Alltags
Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef
Ohne Frieden ist alles nichts
Jahresrückblick Literatur 2025
Zwei Listen, zwei Realitäten: Was Bestseller über das Lesen erzählen

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt
Bergwelt als Textur – Mignon Kleinbek: Wintertöchter. Die Gabe
Hanns-Josef Ortheils „Schwebebahnen“ – Kindheit über Abgründen
Georgi Gospodinovs „Der Gärtner und der Tod“ ist Buch des Jahres der SWR Bestenliste
Das Literarische Quartett am 5. Dezember 2025
Aktuelles
Globalisierung, Spionage, Bestseller: „druckfrisch“ vom 15.02.2026
Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag
Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort
Die Überforderung der Welt – Anton Tschechows „Grischa"

Alina Sakiri: Gedicht – Echt, unbearbeitet

Yasmin: Gedicht
Torben Feldner: Es waren zwei Lichter – Leseprobe

Holger Friedel: Sinn des Lebens
Die Verwaltung des Wahnsinns – Anton Tschechows „Krankensaal Nr. 6
Bekanntgabe des Deutschen Buchhandlungspreises 2025
Selfpublishing-Buchpreis 2025/26 – Zwischen Longlist und Bühne
Nach dem Lärm – Fastenzeit als Übung des Geistes
Die Kunst der Fläche – Warum Tschechows „Die Steppe“ unserer Gegenwart das Dramatische entzieht
Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?
Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen
Rezensionen
Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel
Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird
Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird
Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet
Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend
The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst
Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage
Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit