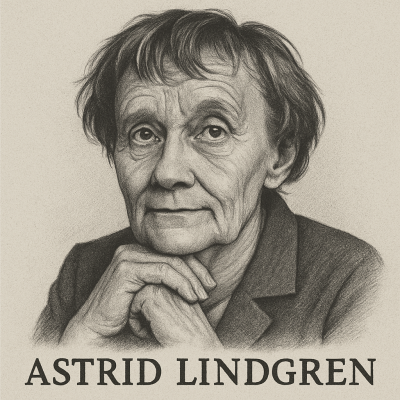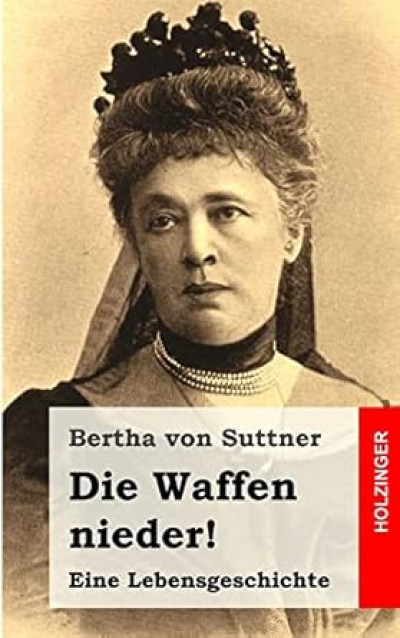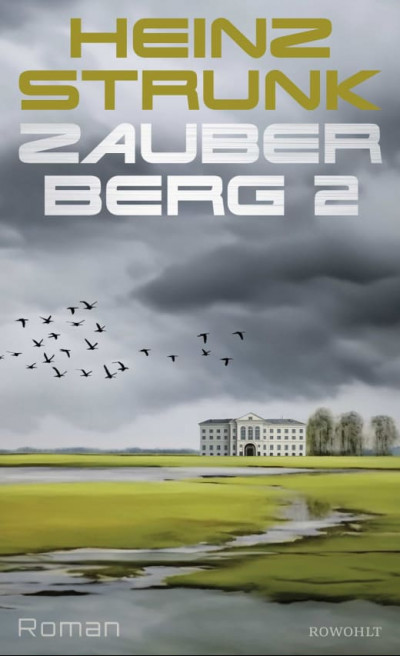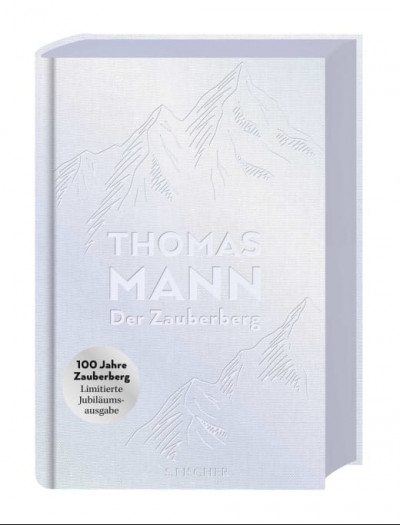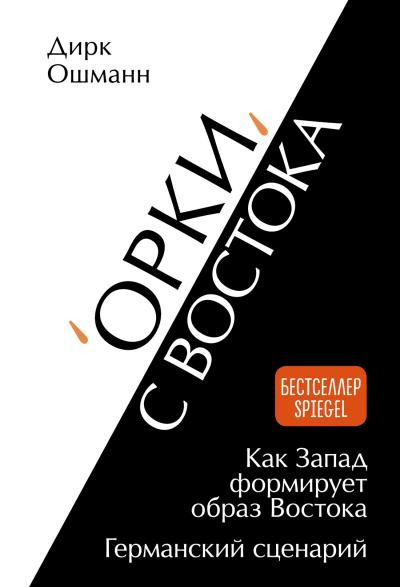Eine Frau singt in einem Wald auf Sachalin. Keine Bühne, kein Publikum, nur Atem, Stimme, Wind. Dieser Gesang – so erzählt es Tatsuzō Ishikawa – genügt, um eine Weltrepublik zu Fall zu bringen. Maschinen verstummen, Sender brechen ab, die Ordnung löst sich auf. Es ist ein leiser Anfang für ein lautes Ende. Und ein passender Einstieg in einen Roman, der weniger von Zukunft handelt als von einem alten, nie gelösten Verhältnis: dem zwischen Mensch, Ordnung und Begehren.
Ein Roman ohne Zentrum
Die letzte Utopie erschien 1953 in Japan, nun erstmals auf Deutsch. Der Text verweigert sich der klassischen Romanform. Keine Hauptfigur, keine lineare Handlung, kein psychologischer Innenraum. Stattdessen: Agenturmeldungen, Interviews, Reportagen, Funksprüche. Die Welt spricht über sich selbst, fragmentiert, offiziell, medial vermittelt. Ishikawa baut seine Zukunft aus dem Material der damaligen Gegenwart: Zeitung, Radio, Stimme aus dem Off. Wahrheit entsteht hier nicht aus Erfahrung, sondern aus Archivnummern, Datumszeilen und beglaubigten O-Tönen.
Wir schreiben – im Roman – das Jahr 2026. Nationalstaaten sind Geschichte, Hunger überwunden, Individualismus abgeschafft. Eine Weltrepublik garantiert Frieden, verwaltet durch einige tausend Polizeiroboter. Die Menschen tragen modische Kleidung, ihre Gesichter sind glatt, ihre Zufriedenheit normiert. Alles wirkt leicht, fast heiter. Und gerade darin liegt die Kälte des Textes. Denn diese Heiterkeit ist nicht erlebt, sondern gemeldet.
Der Roman führt diese Ordnung exemplarisch vor. Ein Hormonspezialist aus Buenos Aires verkündet die erfolgreiche Verkürzung menschlicher Schwangerschaften durch das sogenannte Y-Hormon. Die Sprache ist triumphal, sachlich, religiös überhöht. Von der „Überwindung des Fluchs Gottes“ ist die Rede, von optimiertem Glück, von Effizienz. Die Frau erscheint in dieser Konstellation nicht als Subjekt, sondern als Trägerin eines gelungenen Versuchs. Der Körper wird zur Stellschraube, Fortpflanzung zur Verwaltungsgröße.
Ishikawa kommentiert diesen Vorgang nicht. Er stellt ihm lediglich eine andere Stimme zur Seite: die eines japanischen Mediziners, der auf Naturgesetze, historische Erfahrung und demografische Folgen verweist. Verkürzte Tragzeit bedeute verkürzte Lebensdauer. Beschleunigung habe Konsequenzen. Die Republik registriert diese Einwände – und macht weiter. Auch das ist typisch für diesen Roman: Kritik wird gehört, aber nicht wirksam.
Die Lektüre irritiert zunächst. Etwa zwanzig Figuren tauchen auf und verschwinden wieder. Ihre Schicksale bleiben skizzenhaft, wie Meldungen eben. Doch aus dieser formalen Kälte entsteht Spannung. Denn je weiter man liest, desto deutlicher werden die Risse. Die Sprache der Berichte beginnt zu flackern. Die Erklärungen werden kürzer, defensiver. Die Weltrepublik gerät ins Stolpern – nicht durch einen äußeren Feind, sondern durch Überfülle.
Ein besonders scharfes Bild für diesen inneren Widerspruch ist die Unterhaltungskultur der Republik. Im restaurierten Kolosseum von Rom werden Tierkämpfe und Roboterduelle veranstaltet, um den „primitiven Kampfinstinkt“ der Menschen zu befriedigen. Männer und Frauen jeden Alters applaudieren dem Blut. Als Roboter gegeneinander antreten, bleibt die Begeisterung aus. Maschinen bluten nicht. Sie leiden nicht sichtbar. Erst als Roboter jenseits des Programms außer Kontrolle geraten und menschliche Aggression imitieren, wird die Ordnung nervös. Der Vorschlag, ihnen ein Moralsystem einzubauen, wirkt wie eine technische Notlösung für ein anthropologisches Problem.
Schreiben nach der Katastrophe
1953 ist kein neutrales Datum. Japan liegt noch im Schatten des Krieges, der Atombomben, der amerikanischen Besatzung. Die Erfahrung totaler Mobilisierung, technologischer Vernichtung und staatlicher Ideologie sitzt tief. Ishikawa selbst hatte Zensur, Repression und öffentliche Kritik erlebt. Die letzte Utopie entsteht aus diesem Nachhall – nicht als Abrechnung, sondern als Verschiebung.
Statt Militarismus zeigt Ishikawa eine pazifizierte Welt. Statt Mangel: Überfluss. Statt autoritärer Härte: sanfte Verwaltung. Doch die Frage bleibt dieselbe wie im Japan der Nachkriegszeit: Was geschieht mit dem Menschen, wenn Ordnung alles regelt? Wenn Verantwortung ausgelagert wird – an Systeme, Maschinen, Institutionen?
Der Roman ist damit weniger Zukunftsvision als Versuchsanordnung. Ishikawa denkt Moderne zu Ende. Und er traut ihr nicht.
Harmonie und ihr Preis
Wer den Roman ausschließlich mit westlichen Dystopien liest – Orwell, Huxley – übersieht eine wichtige Schicht. Ishikawas Skepsis richtet sich auch gegen ein spezifisch japanisches Ideal: das der Harmonie. Die Weltrepublik funktioniert wie eine globalisierte Version des wa, des sozialen Gleichklangs. Konflikt gilt als Störung, Individualität als Überbleibsel.
Diese Ordnung ist nicht brutal, sondern höflich. Sie arbeitet mit Konsens, Bequemlichkeit, Lebensstil. Lifestyledrogen regulieren Emotionen, Hormoncocktails Sexualität. Roboter übernehmen Arbeit – und bald auch Moral. Der Mensch wird entlastet, bis er nichts mehr trägt.
Gerade hier zeigt sich Ishikawas kulturelle Tiefenschärfe. Die Angst gilt nicht der Maschine selbst, sondern der freiwilligen Selbstauflösung. Der Mensch gibt ab, was ihn anstrengend macht: Entscheidung, Verantwortung, Leidenschaft. Zurück bleibt Zufriedenheit – und Müdigkeit.
Das Jahr 2026: Eine Zukunft, die uns eingeholt hat
Was erleben wir also im Jahr 2026? Keine Weltrepublik, keine Polizeiroboter im engeren Sinn. Und doch wirkt vieles vertraut. Die Idee, Konflikte technisch zu lösen. Der Wunsch nach Sicherheit durch Systeme. Die Debatte um KI-Rechte, um Reproduktionsmedizin, um optimierte Körper und regulierte Identitäten.
Ishikawa beschreibt Roboter, die sich verlieben – mit einer Leidenschaft, die Menschen fremd geworden ist. Er zeigt Aktivisten, die Robotergewerkschaften fordern, aus Sorge vor Ausbeutung. Und er erzählt von einer Gesellschaft, die an unerwiderter Liebe zu einer Operndiva massenhaft zerbricht. Auch hier spricht nicht das Pathos, sondern die Statistik.
Besonders scharf ist Ishikawas Blick auf Rassismus. Offiziell überwunden, kehrt er über Umwege zurück – in der Hautfarbe von Arbeitsrobotern. Die Empörung ist groß, die Reaktion brutal. Ein General schlägt vor, den Konflikt durch gegenseitige Vernichtung zu lösen. Der Satz steht nackt im Raum. Keine Ironie. Nur Logik.
Hier zeigt sich, was Ishikawa meint, wenn er von menschlicher Natur spricht. Nicht als Essenz, sondern als Rest. Etwas, das sich nicht verwalten lässt.
Gesang gegen das System
Am Ende ist es keine Revolution, kein Aufstand, keine Technologie, die die Weltrepublik zerstört. Es ist Gesang. Ungeplant, unproduktiv, nicht vermittelbar. Die Stimme der Ziegenhirtin Anna entzieht sich jeder Funktion. Sie erinnert an etwas Vor-Zivilisatorisches, an Körper, Atem, Rhythmus.
Diese Szene ist mehr als ein Symbol. Sie ist Ishikawas leise These: Dass Systeme an dem zerbrechen, was sie nicht integrieren können. Nicht am Widerstand, sondern an Sinnlichkeit.
Die letzte Utopie ist kein warnender Roman im lauten Sinn. Er predigt nicht, er droht nicht. Er beschreibt. Präzise, kühl, mit satirischem Unterton. Und genau darin liegt seine Aktualität.
Denn die Frage, die Ishikawa stellt, bleibt offen:
Wie viel Ordnung verträgt ein Mensch – bevor er verschwindet?
Über den Autor und weitere Mitwirkende
Tatsuzō Ishikawa wurde 1905 in Akita, Japan, geboren. Er zählt zu den prägenden Stimmen der japanischen Literatur des 20. Jahrhunderts, insbesondere der Nachkriegszeit. Bereits 1935 erhielt er den Akutagawa-Preis. 1970 wurde er als Kandidat für den Literatur-Nobelpreis gehandelt. Ishikawas Werk kreist um Kriegserfahrung, politische Macht, technologische Moderne und die Fragilität gesellschaftlicher Ordnungen. Er starb 1985 in Tokio.
Sabine Mangold, geboren 1957, studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Japanologie. Sie gehört zu den profiliertesten Übersetzerinnen japanischer Literatur ins Deutsche. Zu den von ihr übertragenen Autorinnen und Autoren zählen unter anderem Haruki Murakami, Yoko Ogawa und Kazuaki Takano. 2019 wurde sie mit dem Übersetzerpreis der Japan Foundation ausgezeichnet.
Yuri Mizobuchi, geboren 1982 in Japan, studierte Musikwissenschaft und arbeitete musikalisch in Osaka, Kyoto und Wien. Seit 2014 lebt sie in Berlin und ist im musikalischen Bereich tätig. Ihre Arbeit bewegt sich zwischen Übersetzung, Musikpraxis und kultureller Vermittlung.
Topnews
Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
Erich Kästner: Fabian oder Der Gang vor die Hunde
Die Kunst der Fläche – Warum Tschechows „Die Steppe“ unserer Gegenwart das Dramatische entzieht
Das Ungelehrte Wissen – Daoistische Spuren in Hesses Siddhartha
Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne
Leo Tolstoi: Anna Karenina
Zärtlich ist die Nacht – Das leise Zerbrechen des Dick Diver
Kafka am Strand von Haruki Murakami
E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ als unruhige Studie über Wahrnehmung
Karen W. – Eine Resonanz des Alltags
Jack London lesen: Vier Bücher und der Ursprung eines amerikanischen Erzählens
Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef
„Ein Faden, der sich selbst spinnt“ – Jon Fosses Vaim und der Rhythmus der Abwesenheit

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt
Bergwelt als Textur – Mignon Kleinbek: Wintertöchter. Die Gabe
Stimmen aus der Stille von Yahya Ekhou: Frauen in Mauretanien, Selbstbestimmung und die Kraft biografischer Literatur
Aktuelles

Your Knife, My Heart von K. M. Moronova – Dark-Military-Romance, die nicht nur „spicy“, sondern gefährlich ist
Bald ist es soweit: Die Literaturbühnen der Leipziger Buchmesse starten ins Frühjahr
Demagogie 2.0 – das alte neue Machtprinzip
Frankie von Jochen Gutsch & Maxim Leo – Ein Kater als Erzähler, ein Mensch am Rand
Alexander von Ferdinand von Schirach – Wenn ein Kinderbuch plötzlich über die großen Dinge spricht
Morgan’s Hall: Eisland von Emilia Flynn – Das Finale im Frost
Morgan’s Hall: Schattenland von Emilia Flynn – Wenn Vergangenheit nicht stirbt, sondern nur leiser wird
Morgan's Hall: Schicksalsland – Glück fühlt sich in dieser Reihe nie stabil an
Leonie: Ein Gesicht oder doch vielleicht mein Gesicht?
Erich Kästner: Fabian oder Der Gang vor die Hunde
Zwischen Gedicht und Geopolitik – Die Shortlist des Sheikh Zayed Book Award 2026
Erfolgreiche Lernkultur gestalten: Wie Unternehmenskultur nachhaltige Kompetenzentwicklung ermöglicht
Paweł Markiewicz: Die Piratin in der Taverne II

S.A.Riten – Ausgewählte Texte
Robert Menasse: Die Lebensentscheidung – Europa im Angesicht des Endes
Rezensionen
Morgan’s Hall: Ascheland von Emilia Flynn – Nach der großen Liebe kommt der Alltag
Morgan’s Hall: Niemandsland von Emilia Flynn – Wenn das „Danach“ gefährlicher wird als das „Davor“
Morgan’s Hall: Sehnsuchtsland von Emilia Flynn – Wenn Sehnsucht zum Kompass wird
Morgan’s Hall: Herzensland von Emilia Flynn – Wenn Geschichte plötzlich persönlich wird
Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?
Ostfriesenerbe von Klaus-Peter Wolf – Wenn ein Vermächtnis zur Falle wird
Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag
Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort
Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?
Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen
Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln