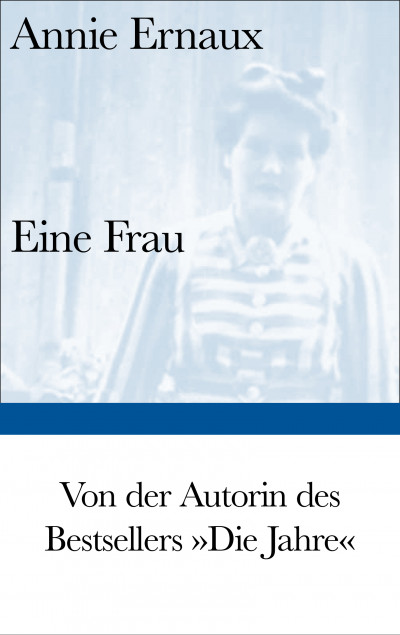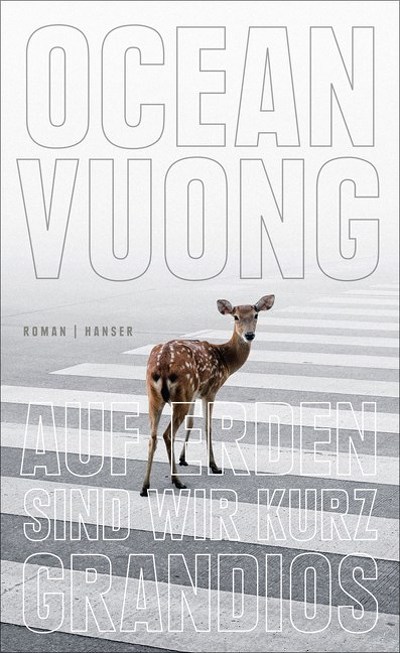„Ich gehe mit Ralph, wohin auch immer das sein mag. Versuche, dein Leben zu machen“
„Versuche, dein Leben zu machen“ – Margot Friedländers Zeugnis über Würde im Versteck und die bleibende Last der Erinnerung
Dieser eine Satz – auf einem kleinen Zettel hinterlassen – ist alles, was Margot Friedländer von ihrer Mutter bleibt.
Ein Satz, der zur Lebensaufgabe wird.
Versuche, dein Leben zu machen ist weit mehr als eine Autobiografie. Es ist ein Akt des Erinnerns – gegen das Vergessen, gegen das Schweigen, gegen die historische Vereinfachung. Margot Friedländer, die sich als junge Jüdin 1943 allein in Berlin vor der Deportation verstecken muss, schildert mit erschütternder Klarheit, was es bedeutet, verfolgt, verraten – aber auch gerettet zu werden.
Ein Buch, das keine literarischen Schnörkel braucht, weil jedes Wort aus gelebter Erfahrung stammt. Und ein Text, der in Zeiten von aufkeimendem Antisemitismus, Geschichtsvergessenheit und medialem Lärm notwendiger ist denn je.
Worum geht es in „Versuche, dein Leben zu machen“?
Anfang 1943 wird Margots Bruder Ralph von der Gestapo verhaftet. Ihre Mutter, deren Deportation unmittelbar bevorsteht, entscheidet sich, freiwillig mitzugehen – eine Geste der familiären Loyalität in einer Zeit der Entmenschlichung.
Margot bleibt allein zurück. Ohne Schutz, ohne gültige Papiere, mit gefärbten Haaren und falschem Namen taucht sie in Berlin unter – und lebt über 15 Monate versteckt bei Bekannten, mutigen Helfern, aber auch aus reinem Eigennutz Mitwissenden.
Sie erlebt Verrat, Flucht, Isolation, Angst – und mehrfaches Entkommen. Im April 1944 wird sie schließlich verhaftet und nach Theresienstadt deportiert. Dort überlebt sie das Kriegsende und beginnt Jahre später – aus den USA zurückgekehrt – das aufzuschreiben, was nie vergessen werden darf.
Erinnerung als moralische Verpflichtung
Margot Friedländers Bericht ist nicht nur historisches Dokument, sondern moralischer Kompass. Er zeigt: Verfolgung geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern mitten unter Menschen.
Die deutsche Gesellschaft der 1940er Jahre ist in ihrer Haltung keineswegs einheitlich. Es gibt Helfer, die ihr Leben riskieren. Es gibt Gleichgültige. Und es gibt die, die bereitwillig verraten. Friedländer beschreibt all das ohne Anklage, aber mit tiefer Beobachtung – nüchtern und präzise.
Das macht das Buch so wertvoll für die Gegenwart. Denn es erinnert daran, dass Zivilcourage nicht heroisch, sondern konkret ist – oft leise, oft unsichtbar, aber lebensentscheidend.
Stilistische Einordnung – Klarheit statt Pathos
Der Stil ist geprägt von einer fast dokumentarischen Nüchternheit. Keine überladenen Bilder, keine emotionalen Ausbrüche – und gerade deshalb von großer Wirkung.
Malin Schwerdtfegers redaktionelle Begleitung macht das Buch strukturell zugänglich, ohne seine Authentizität zu glätten. Die Sprache ist einfach, aber eindringlich; die Perspektive nie larmoyant, sondern beobachtend, oft sogar kontrolliert – als wolle die Autorin sich selbst nicht zu viel Raum geben.
Diese Zurückhaltung ist keine Schwäche, sondern die Stärke des Textes. Der Schmerz wird nicht ausformuliert, er steht zwischen den Zeilen – spürbar, aber nie explizit ausgestellt.
Was dieses Buch einzigartig macht
Im Kanon der Holocaustliteratur nimmt Versuche, dein Leben zu machen eine besondere Position ein. Es ist nicht die Geschichte der Deportation – sondern die des Dazwischen. Die Zeit im Untergrund.
Während Werke wie Wenn das Leben noch einen Sinn hat (Frankl) oder Das Tagebuch der Anne Frank das Leben im Lager oder im Versteck zeigen, schildert Friedländer den schmalen Grat zwischen Sichtbarkeit und Verschwinden im öffentlichen Raum.
Sie bewegt sich unter Menschen – unerkannt, aber immer gefährdet. Diese besondere Konstellation (untergetaucht in Berlin) ist selten beschrieben und gibt dem Buch hohe historische Relevanz. Es erweitert die Perspektive der Shoah-Literatur um eine Realität, die oft übersehen wird: das jüdische Überleben in der Illegalität – mitten in der deutschen Hauptstadt.
Für wen ist dieses Buch unverzichtbar?
-
Für alle, die sich mit NS-Zeit und Erinnerungskultur auseinandersetzen
-
Für Menschen, die persönliche Zeugnisse der Shoah jenseits von Lagerberichten suchen
-
Für Leser, die begreifen wollen, wie Einzelne handeln – und wie entscheidend das sein kann
-
Für Bildungskontexte, politische Bildungsarbeit, Lesekreise oder Gedenkinitiativen
Kritische Reflexion – Stärken und begrenzende Faktoren
Stärken:
-
Unverstellte Perspektive einer Betroffenen
-
Hoher Quellenwert durch Zeitzeugenschaft
-
Sprachliche Klarheit, die Raum für Empathie lässt
-
Historisch differenziert und frei von Pauschalisierung
Begrenzung:
-
Einzelne Kapitel wirken kürzer skizziert; manche Abschnitte könnten emotional noch stärker vertieft werden
-
Durch die lange Zeitspanne zwischen Erlebnis und Niederschrift fehlt stellenweise narrative Dichte – was zugleich die Authentizität unterstreicht
Ein stilles, starkes Buch gegen das Vergessen
Versuche, dein Leben zu machen ist kein Buch, das sich aufdrängt – aber eines, das bleibt. Es erzählt keine Heldengeschichte, sondern eine Geschichte der Würde im Unsichtbaren.
Margot Friedländer zeigt, wie man trotz allem überlebt – und wie Erinnerung zur Haltung wird. Ein Zeugnis, das man lesen sollte. Ein Mensch, dem man zuhören muss.
Über die Autorin – Margot Friedländer
Margot Friedländer wurde 1921 in Berlin geboren und überlebte die NS-Zeit als untergetauchte Jüdin, bevor sie in das KZ Theresienstadt deportiert wurde. Nach dem Krieg emigrierte sie in die USA, kehrte aber 2003 nach Deutschland zurück.
Seither tritt sie unermüdlich als Zeitzeugin auf, besonders in Schulen, Bildungseinrichtungen und Gedenkstätten. Für ihr Engagement wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der Ehrenbürgerschaft Berlins.
Ihr Credo: „Ich bin nicht aus Hass zurückgekommen, sondern aus Verantwortung.“ Dieser Satz begleitet auch das Buch.
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt von Maya Angelou – Ein Mädchen, eine Stimme, ein Land im Fieber

Mr Nice von Howard Marks: Aufstieg des Haschisch-Königs & wahre Hintergründe
Sonny Boy: Al Pacinos autobiografischer Wegweiser durch Filmkunst und Leben
Kleinhirn an alle: Otto Waalkes’ humoristische Biografie mit Tiefgang
„Miro – Die offizielle Biografie von Miroslav Klose“: Wie aus einem Zimmermann Deutschlands WM-Rekordtorschütze wurde
„Hoffe: Die Autobiografie“ von Papst Franziskus – Was sein Leben über die Welt von heute erzählt
Vor den Augen der Welt – Eine Rezension zu Simon Shusters Biografie über Wolodymyr Selenskyj
Erinnerungen eines stillen Exzentrikers
Ein Werk, das ein Leben rechtfertigen soll
"Über Liebe und Magie" von John Burnside: Eine große Hoffnung
Abschied von einem geliebten Klassenfeind
Auf der Suche nach einer verlorenen Sprache
Doch Gott ist weiß
Ein Stein auf meinem Herzen
“White Line Fever” von Lemmy Kilmister: Eine kompromisslose Reise durch Sex, Drogen und Rock’n’Roll
Aktuelles
Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land
Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee
Der König von Narnia von C. S. Lewis – Durch den Pelzmantel in die Ethik
Das Wunder von Narnia von C. S. Lewis – Wie aus einer Kinderspielerei eine Welt entsteht
The Dog Stars von Peter Heller – Eine Endzeit, die ans Herz greift, nicht an den Puls
Sturmhöhe von Emily Brontë – Liebe als Windbruch
Kurs halten, Markt sichern: Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef
Primal of Blood and Bone – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Der Blick nach vorn, wenn alles zurückschaut
Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird
War and Queens – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn Gefühle zum Kriegsgerät werden
Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne
Goethe in der Vitrine – und was dabei verloren geht Warum vereinfachte Klassiker keine Lösung, sondern ein Symptom sind
Leo Tolstoi: Anna Karenina
Zärtlich ist die Nacht – Das leise Zerbrechen des Dick Diver
Kafka am Strand von Haruki Murakami
Rezensionen
Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein
Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle