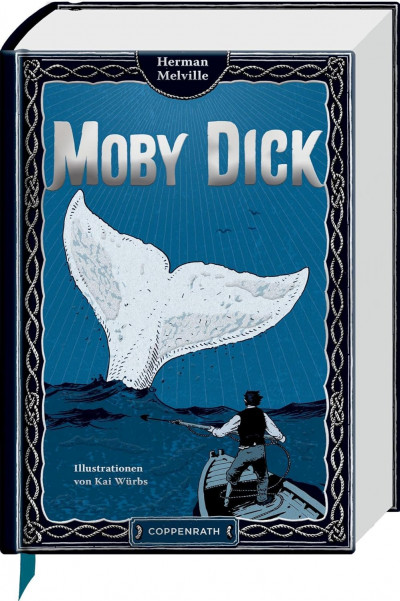Charles Dickens veröffentlichte seinen historischen Roman A Tale of Two Cities im Jahr 1859 zunächst in Fortsetzungen in seiner eigenen Zeitschrift All the Year Round. Die deutsche Übersetzung erschien erstmals Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Titel Eine Geschichte aus zwei Städten, später auch als Eine Geschichte von zwei Städten oder schlicht Eine Geschichte zweier Städte. Heute ist der Roman in zahlreichen Ausgaben erhältlich, darunter bei dtv, Reclam oder Anaconda.
Aktuell erlebt der Stoff neue Aufmerksamkeit: Die BBC arbeitet an einer vierteiligen Miniserie, die 2026 erscheinen soll und die bekannten Motive von Liebe, Revolution und Opfer erneut für ein modernes Publikum inszeniert. Damit kehrt Dickens’ Roman aus den Lehrplänen und Bibliotheken zurück auf den Bildschirm – mit allen Chancen und Risiken, die eine Aktualisierung klassischer Literatur mit sich bringt.
Worum geht’s?
Die Geschichte setzt im Jahr 1775 ein, in einer Welt, die Dickens gleich im ersten Satz als von Gegensätzen durchzogen beschreibt: es war die „beste Zeit“ und die „schlechteste Zeit“. In England herrscht äußerlich Ruhe, in Frankreich hingegen gärt der Unmut, der bald in die Revolution münden wird.
Im Zentrum steht der Arzt Dr. Alexandre Manette, der nach achtzehn Jahren unrechtmäßiger Haft in der Bastille wie ein lebender Toter nach London zurückkehrt. Dort findet er durch die Fürsorge seiner Tochter Lucie langsam ins Leben zurück. Lucie, sanft und unerschütterlich, wird bald zum Anker für die Schicksale der Männer um sie.
Charles Darnay, ein junger französischer Aristokrat, der den Namen und die Privilegien seiner Familie verachtet, sucht in London ein neues Leben. Er liebt Lucie und gewinnt ihr Herz. Parallel dazu tritt Sydney Carton auf, ein Anwalt, der äußerlich Darnay gleicht, innerlich aber sein Gegenstück ist: ein Trinker, ein Zyniker, zermürbt von Selbsthass, doch fähig zu einer stillen, aufopfernden Liebe zu Lucie. Zwischen Darnay und Carton entfaltet sich ein stilles Drama, das nicht Rivalität, sondern Schicksalsgemeinschaft bedeutet.
Als die Französische Revolution ausbricht, kehrt Darnay nach Paris zurück, um einem alten Diener seiner Familie beizustehen. Doch dort wird er von den Revolutionstribunalen als Aristokrat angeklagt und zum Tod verurteilt. Lucie und ihr Vater folgen ihm, verzweifelt bemüht, sein Leben zu retten. Madame Defarge, die unbarmherzige Rachegestalt des Romans, verfolgt die Familie mit eisigem Eifer, während die Guillotine in der Stadt unaufhörlich Opfer fordert.
Hier tritt Sydney Carton ein letztes Mal hervor. Er erkennt in Darnay den Mann, den Lucie liebt, und entschließt sich, an seiner Stelle zu sterben. Durch ihre äußere Ähnlichkeit gelingt es ihm, Darnay aus dem Gefängnis zu befreien und selbst in die Zelle zu treten. In einer der eindringlichsten Szenen des Romans geht er den Weg zur Guillotine, wissend, dass sein Opfer Lucie und ihre Familie retten wird.
Seine letzten Gedanken bilden das berühmte Schlusswort, das Dickens’ Werk unsterblich gemacht hat:
„It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known.“
oder in poetischer deutscher Übersetzung:
„Es ist ein weitaus besseres Tun, das ich vollbringe, als alles, was ich bisher getan habe; es ist eine weitaus bessere Ruhe, zu der ich eingehe, als ich je gekannt habe.“
Damit vollzieht Carton eine radikale Umkehrung: aus einem vergeudeten Leben wird im Tod ein Akt von Würde und Liebe.
Ist dies sein bester Roman gewesen?
Eine Geschichte zweier Städte gilt als einer der meistgelesenen Romane der Welt – Schätzungen zufolge über 200 Millionen verkaufte Exemplare. Der Erfolg ist nicht zuletzt der Mischung aus historischem Drama und moralischer Parabel geschuldet. Dickens schrieb hier nicht die typischen Chroniken des viktorianischen Alltags, sondern ein Werk von europäischem Ausmaß. Statt Londoner Armenhäusern oder Schuldnergefängnissen bildet die Guillotine das Zentrum der Handlung.
Im Vergleich zu Oliver Twist oder David Copperfield ist der Roman weniger stark von autobiografischen Motiven durchzogen und auch sprachlich disziplinierter. Dickens verzichtet weitgehend auf humoristische Abschweifungen, skurrile Nebenfiguren oder detailreiche Milieustudien, die seine anderen Bücher prägen. Stattdessen entsteht eine straffe, beinahe biblische Erzählung, die zwischen Pathos und Schicksalsdrama balanciert.
Kritiker haben dem Roman gelegentlich vorgeworfen, dass die Figuren archetypisch, ja schematisch wirken – Charles Darnay als edler Aristokrat, Lucie als engelsgleiche Geliebte, Carton als tragischer Erlöser. Doch gerade in dieser Typisierung liegt die Wirkung: Dickens zeichnet weniger psychologische Feinheiten als vielmehr moralische Kontraste, die in der historischen Kulisse grell aufleuchten.
Die politische Dimension bleibt ambivalent. Dickens zeigt die Gräuel der Revolution, ohne das Elend der unterdrückten Bevölkerung zu leugnen. Er macht verständlich, warum der Sturm auf die Bastille unausweichlich war, gleichzeitig aber auch, wie Gewalt sich verselbstständigt und zur unaufhaltsamen Maschine wird. Damit legt der Roman ein Muster frei, das bis ins 20. und 21. Jahrhundert hinein Gültigkeit behielt: Revolutionen fressen ihre Kinder, Gerechtigkeit wird im Blutrausch korrumpiert.
Ob dies Dickens’ „bester“ Roman ist, bleibt eine Geschmacksfrage. David Copperfield wurde von ihm selbst als sein Lieblingswerk bezeichnet, und viele Literaturhistoriker sehen in Bleak House sein reifstes Buch. Doch Eine Geschichte zweier Städte ist ohne Zweifel sein am meisten zitierter und international erfolgreichster Text – weniger typisch dickensianisch, dafür universeller.
Moral und Geschichte
Eine Geschichte zweier Städte ist ein Roman von ungewöhnlicher Wucht im Werk von Charles Dickens. Er vereint historische Recherche mit dramatischer Verdichtung und moralischer Klarheit. Wer Dickens nur als Chronisten viktorianischer Sozialmiseren kennt, entdeckt hier einen Erzähler, der den großen europäischen Umbruch zwischen Monarchie und Revolution in ein menschliches Drama verwandelt.
Die Popularität des Romans erklärt sich aus seiner Mischung aus Liebesgeschichte, historischer Spannung und einem Finale, das in seiner pathetischen Einfachheit fast liturgisch wirkt. Auf jeden Fall Dickens’ meistgelesenes Buch und eines, das bis heute in Schulen, Bühnenfassungen und Verfilmungen weiterlebt.
Autor
Charles Dickens (1812–1870) war der wohl einflussreichste englische Erzähler des 19. Jahrhunderts. Mit Romanen wie Oliver Twist, David Copperfield, Bleak House oder Great Expectations wurde er zum Chronisten der sozialen Missstände des viktorianischen England. Zugleich verband er Gesellschaftskritik mit erzählerischem Witz, plastischen Figuren und moralischer Ernsthaftigkeit. Mit Eine Geschichte zweier Städte wagte er sich aus dem heimischen Terrain hinaus auf das europäische Parkett – und schuf damit einen seiner international bekanntesten Texte.
Kitsch, Rollenklischees und moderne Rezeption
So erhaben Dickens’ Roman im Ton wirkt, so sehr ist er auch ein Kind seiner Zeit – und manchmal kaum mehr als ein Spiegel viktorianischer Sentimentalität. Tränen, Opfer, Erlösung: der Stoff, aus dem Melodramen gemacht sind. Der Pathos der letzten Szene mag für viele Leser bewegend sein, für andere kippt er ins Kitschige.
Hinzu kommen die Rollenbilder. Lucie Manette ist ein Musterbeispiel des „Engels im Haus“: passiv, sanft, aufopfernd. Ihre Aufgabe ist es, Männer zu retten, nicht sich selbst. Madame Defarge hingegen verkörpert die andere Seite: das übersteigerte Bild der gefährlich-rachsüchtigen Frau. Psychologische Nuancen fehlen, und moderne Leserinnen und Leser spüren deutlich, wie eng die Schablonen sind.
Dass sich genau diese Mischung aus Rührung, Liebe und moralischer Gerechtigkeit filmisch gut verkaufen lässt, überrascht kaum. Schon zahlreiche Verfilmungen haben den Stoff ausgeschlachtet, und mit der neuen BBC-Miniserie, die 2026 erscheinen soll, steht die nächste Aktualisierung bevor. Sie verspricht, die Dreiecksbeziehung zwischen Darnay, Lucie und Carton erneut in den Mittelpunkt zu rücken – womit die emotionale Zuspitzung klar im Vordergrund steht.
So bleibt Eine Geschichte zweier Städte bis heute ein ambivalentes Werk: ein Stück Weltliteratur, das in seiner Wucht bewegt, aber auch in seiner Rührseligkeit und seinen Geschlechterklischees herausfordert. Und vielleicht erklärt gerade diese Mischung, warum der Stoff immer wieder auf die Leinwand und in Serienfassungen zurückkehrt – Tränen, Liebe und Gerechtigkeit lassen die Kassen klingeln.
Hier bestellen
Topnews
Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
Leo Tolstoi: Anna Karenina

Johanna Hansen: SCHAMROT: Eine niederrheinische Kindheit
Kein Dach, kein Zuhause – The Family Under the Bridge und das andere Weihnachten
Moby-Dick – Melvilles grandioser Kampf zwischen Mensch und Mythos
Sebastian Haffner – Abschied
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Der Leopard – Der Untergang einer Welt
Sehr geehrte Frau Ministerin von Ursula Krechel
„100 Seiten sind genug. Weltliteratur in 1-Stern-Bewertungen“ von Elias Hirschl
Han Kang: Unmöglicher Abschied
Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen
„Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez
Robert Harris: Abgrund – Ein Politthriller über Liebe, Macht und Verrat
"Faust II": Der Mensch als unermüdlich Streben
"Faust I" – Beginnend mit dem Osterspaziergang: Ein ewiges Verlangen nach mehr
Kafka. Um sein Leben schreiben
Aktuelles
Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?
Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen
Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel
Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird
Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird
Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet
Das Ungelehrte Wissen – Daoistische Spuren in Hesses Siddhartha
Leykam stellt Literatur- und Kinderbuchprogramm ab 2027 ein
Fasching in der Literatur: warum das Verkleiden selten harmlos ist
Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend
The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst
Leipzig liest: Von Alltäglichkeiten, Umbrüchen und der Arbeit am Erzählen
Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage
Nicolas Mahler erhält 2026 Wilhelm-Busch-Preis und e.o.plauen-Preis
Rezensionen
Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit