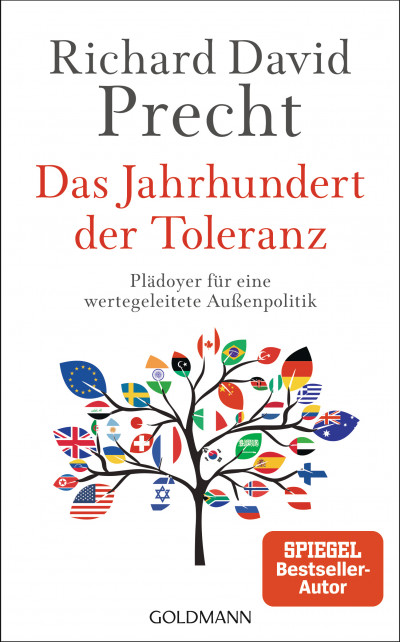Manche Bücher sprechen Klartext. Andere heben den Ton. Nach uns die Zukunft tut beides. Marcel Fratzscher, Wirtschaftswissenschaftler von Rang und nicht eben für theatralische Auftritte bekannt, legt ein Plädoyer vor, das sich in seiner Argumentation unaufgeregt gibt – und dabei umso entschlossener an die Substanz geht: den brüchigen Generationenvertrag, auf dem unsere Gesellschaft beruht.
Fratzschers Diagnose: Der Pakt zwischen Jung und Alt ist aus dem Gleichgewicht geraten. 84 Prozent der Bevölkerung glauben, dass es der nächsten Generation schlechter gehen wird als der vorherigen. Diese düstere Einschätzung, so Fratzscher, ist kein Ausdruck diffuser Weltuntergangsstimmung – sondern ein rationales Urteil angesichts politischer Versäumnisse, wirtschaftlicher Schieflagen und ökologischer Grenzüberschreitungen.
Nach uns die Zukunft – Marcel Fratzschers Entwurf eines neuen Generationenvertrags
Worum es geht
Fratzscher entwirft die Grundlagen eines neuen Generationenvertrags, der Rechte und Pflichten neu austariert: das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, auf einen intakten Planeten, auf gesellschaftliche Teilhabe – aber auch die Pflicht zu Solidarität, zur Verantwortung und, ja, zu einem gewissen Maß an Verzicht.
Er führt durch Themenfelder wie Bildung, Klima, Rente, Staatsverschuldung und Demokratie, stets entlang der Frage: Wie verteilen wir Lasten gerecht zwischen den Generationen – und was schulden wir jenen, die noch gar nicht geboren sind? Die Antwort fällt weniger ideologisch als methodisch aus: Fratzscher bietet wirtschaftspolitische Szenarien, benennt Fehlanreize, diskutiert Steuer- und Sozialmodelle. Das alles in einem Ton, der weit entfernt bleibt von jener Alarmrhetorik, die häufig dort einsetzt, wo die Argumente enden. Hier aber tragen sie. Eine kritisch-analytische Gegenlektüre zur Frage „Verteilen vs. Erwirtschaften“ finden sie auf experten.de.
Von der Pflicht – Rentnerjahr und Gesellschaftsjahr
Mit seiner Forderung nach einem verpflichtenden sozialen Jahr für Rentner hat Fratzscher eine Debatte angestoßen, die weit über ökonomische Parameter hinausweist. Sein Vorschlag, Ruheständler zur aktiven Mitwirkung in sozialen oder sicherheitsrelevanten Bereichen zu verpflichten – etwa in der Pflege oder im Bereich der zivilen Verteidigung –, liest sich als Replik auf eine Schieflage, die er präzise benennt: Die Lasten sind ungleich verteilt, die Jungen tragen den Großteil – finanziell wie klimatisch –, während die Älteren von einem System profitieren, das sie zu wenig hinterfragen.
„Wir leben noch in einer Fantasiewelt“, sagt Fratzscher im SPIEGEL-Interview. „Viele wollen nicht wahrhaben, dass wir nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Weder wirtschaftlich noch politisch oder gesellschaftlich sind wir auf einem nachhaltigen Pfad.“ (Der Spiegel, 35/2025)
Hier knüpft Fratzschers Ansatz an einen Gedanken an, den Richard David Precht bereits 2021 in seinem Essay Von der Pflicht formulierte: die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres nicht nur für junge Menschen nach der Schule, sondern auch beim Übergang in den Ruhestand. Während Fratzschers Argumentation auf wirtschaftlicher und demografischer Analyse fußt, stellt Precht seine Forderung normativ-philosophisch auf – als Rückbesinnung auf ein Verhältnis zwischen Bürger und Staat, das nicht nur auf Rechten, sondern auch auf Pflichten gründet.
Beide eint die Überzeugung, dass eine demokratische Gesellschaft auf aktiver Teilhabe aller beruht – auch jener, die lange Zeit von ihrem Gemeinwesen profitiert haben. Die Vorstellung eines „Rentenjahres“ wird damit nicht nur zur fiskalischen Notwendigkeit, sondern zum Ausdruck einer solidarischen Ethik. Dass dieser Vorschlag polarisiert – zwischen dem Vorwurf moderner Bevormundung und dem Ruf nach gerechter Lastenverteilung – ist Teil seiner gesellschaftspolitischen Sprengkraft.
Zwischen Präzision und Provokation
Der Titel Nach uns die Zukunft ist eine doppelte Volte: Anspielung auf das berüchtigte „Nach uns die Sintflut“, aber auch ein Gegenbild – ein Appell an Zukunftsfähigkeit statt Abwicklung. Fratzscher will nicht polarisieren, sondern differenzieren. Dass ihm das gelingt, liegt auch an seiner sprachlichen Disziplin: nüchtern, durchdacht, gelegentlich mit leiser Ironie durchsetzt, aber nie redundant.
Wenn er etwa über das Rentensystem schreibt, dann nicht als Systemverächter, sondern als einer, der dessen ursprüngliche Idee retten will – gegen seine aktuellen Verzerrungen. „Die Rente in Deutschland schützt nicht mehr verlässlich vor Bedürftigkeit. Das ist ein Armutszeugnis“, erklärt Fratzscher und fordert stattdessen einen Ausgleich von Reich zu Arm (Der Spiegel, 35/2025). Wenn er den Begriff der „grünen Inflation“ einführt, dann nicht als moralische Keule, sondern als ökonomische Notwendigkeit: Ein Kilo Rindfleisch, so rechnet er nüchtern vor, müsste eigentlich vier- bis fünfmal so teuer sein, um seine wahren Kosten abzubilden.
Keine bequeme Lektüre
Man mag Marcel Fratzschers ideologischer Ausrichtung nicht in jedem Punkt folgen wollen. Auch seine Vorschläge – vom Boomer-Soli bis zum verpflichtenden Rentnerjahr – lassen sich durchaus kritisieren, sei es aus politischer, praktischer oder moralischer Perspektive. Doch eines lässt sich schwerlich bestreiten: Er hat recht damit, dass die Frage nach Generationengerechtigkeit ganz oben auf unsere gesellschaftliche Agenda gehört.
Wie schon Richard David Precht in seinem Essay Von der Pflicht erinnert auch Fratzscher daran, dass eine funktionierende Demokratie mehr verlangt als individuelle Rechte und freie Konsumentscheidungen. Sie verlangt Verantwortung – und eine neue Balance zwischen den Generationen. Wer sich davor drückt, wird am Ende mehr verlieren als er zu geben fürchtet.
Autor Marcel Fratzscher:
Marcel Fratzscher, geboren 1971, ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er berät Bundesregierung und internationale Gremien, publiziert regelmäßig in ZEIT Online und anderen Medien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Makroökonomie, soziale Ungleichheit und die Zukunft des Sozialstaats.
Hier bestellen
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Richard David Precht: Soziales Pflichtjahr "wird unserer Gesellschaft viel Gutes tun"
Kein Dach, kein Zuhause – The Family Under the Bridge und das andere Weihnachten
Rabimmel Rabammel Rabum – St. Martin und Laternenfest
Transit von Anna Seghers
Goldmann Verlag präsentiert: Die neue Graphic Novel zu Richard David Prechts »Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?«
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
SPIEGEL Bestseller Update: Richard David Precht auf Platz 2
Wo der Bürger Kunde wird, ist kein Staat mehr möglich
Aktuelles
„Druckfrisch“-Sendung vom 18. Januar 2026: Spiegel-Bestseller-Sachbuch
„Druckfrisch“ vom 18. Januar 2026
Literatur, die nicht einverstanden ist
Salman Rushdie bei der lit.COLOGNE 2026
Der Sohn des Wolfs – Jack Londons frühe Alaska-Erzählungen
Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher
Wolfsblut – Der Weg aus der Wildnis

Manfred Rath :In den Lüften
Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts
PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg
Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See
Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Rezensionen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle