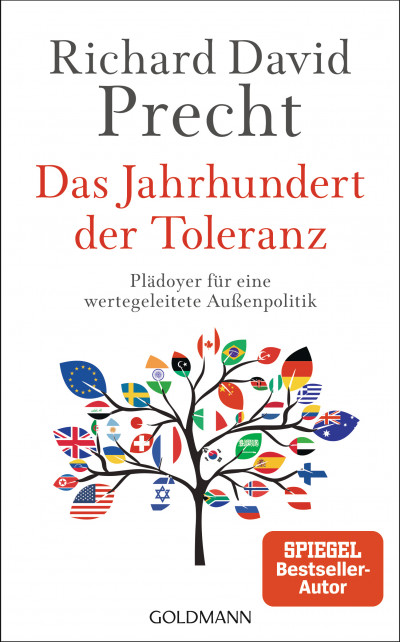Eine Armee ohne Volk und ein Volk ohne Armee – die Geschichte der Bundeswehr ist eine Geschichte des Misstrauens, der Zögerlichkeit und des permanenten Anpassungsdrucks. 1955 gegründet, von Beginn an unter Beobachtung und stets mit einer gewissen Verlegenheit betrachtet, entwickelte sie sich im Kalten Krieg zum Rückgrat der NATO-Landstreitkräfte, wurde nach 1990 drastisch verkleinert und schließlich in eine Interventionsarmee umgebaut, die überall auf der Welt zum Einsatz kam, ohne dass die deutsche Öffentlichkeit so recht wusste, warum. Und dann kam der 24. Februar 2022, der Tag, der alles veränderte, zumindest auf dem Papier. Sönke Neitzel, als einer der profiliertesten Militärhistoriker Deutschlands ohnehin selten um eine klare Analyse verlegen, legt mit Die Bundeswehr. Von der Wiederbewaffnung bis zur Zeitenwende eine präzise und schonungslose Studie vor, die am 20. März 2025 bei C.H. Beck erscheint. Sein Buch zeichnet die Entwicklung der Truppe nach und zeigt, wie wenig von der oft beschworenen "Zeitenwende" bislang in der Realität angekommen ist.
Sönke Neitzel: Die Bundeswehr. Von der Wiederbewaffnung bis zur Zeitenwende
Von der Wiederbewaffnung zur Wehrunlust
Dass die Bundeswehr nie wirklich gewollt war, macht Neitzel gleich zu Beginn klar. Als sie 1955 ins Leben gerufen wurde, geschah das weniger aus innerer Überzeugung als aus geopolitischer Notwendigkeit. Adenauer, pragmatisch wie immer, erkannte die Chance, durch eine Armee die Souveränität der Bundesrepublik zurückzugewinnen, während die Amerikaner angesichts der sowjetischen Bedrohung einen militärischen Beitrag Westdeutschlands für unverzichtbar hielten. Also wurden Truppen aufgestellt, Generäle reaktiviert und NATO-Strukturen übernommen, alles mit einer Mischung aus Widerwillen und Sachzwang. Im Inneren blieb die Skepsis groß, denn während in Frankreich oder Großbritannien das Militär als selbstverständlicher Bestandteil der Nation galt, blieb es in Deutschland ein Fremdkörper, der sich bestenfalls als notwendiges Übel rechtfertigen ließ.
Mit dem Ende des Kalten Krieges fiel dann auch dieser Rechtfertigungsdruck weg, was prompt zur Folge hatte, dass Personal abgebaut, Ausrüstung vernachlässigt und die Wehrpflicht abgeschafft wurde – ein Prozess, der weniger als strategische Neuausrichtung denn als schleichende Selbstaufgabe erschien. Statt Landes- und Bündnisverteidigung stand nun Krisenintervention auf dem Programm, was bedeutete, dass die Bundeswehr von Somalia bis Afghanistan im Einsatz war, ohne dass man ihr jemals so richtig eine Rolle gegeben hätte, die über das politische Pflichtgefühl hinausging.
Zeitenwende oder Zaudern?
Dann die russische Invasion in der Ukraine und mit ihr die große rhetorische Wende: 100 Milliarden Euro, eine neue Sicherheitsarchitektur, eine Armee, die endlich wieder wehrhaft sein sollte. Neitzel zeigt jedoch, dass zwischen Ankündigungen und Realität eine klaffende Lücke besteht. Nicht nur fehlt es an Material und Strukturen, sondern vor allem an einer politischen und gesellschaftlichen Haltung, die eine ernsthafte Verteidigungspolitik überhaupt erst ermöglichen würde. Jahrzehntelang wurde die Bundeswehr kleingespart, ihre Rolle in Frage gestellt und ihr Auftrag immer wieder neu interpretiert – ein Zustand, der sich nicht über Nacht ändern lässt, auch nicht mit Milliardenbeträgen.
Besonders scharf fällt Neitzels Analyse aus, wenn es um die Reformunfähigkeit der Truppe geht. Seit Jahrzehnten wird über Modernisierung gesprochen, doch in der Praxis geschieht wenig, weil Bürokratie, politische Kurzsichtigkeit und eine tiefsitzende Skepsis gegenüber allem Militärischen Fortschritte blockieren. Dass andere NATO-Staaten unter ganz ähnlichen Bedingungen effizientere Streitkräfte aufbauen konnten, zeigt, dass es hier nicht um Sachzwänge geht, sondern um eine deutsche Spezialität: eine Armee, die zwar existieren, aber am besten nicht gebraucht werden soll.
Wer verstehen will, warum die Bundesrepublik sicherheitspolitisch so lange zauderte und warum die aktuelle Wende mehr ein rhetorischer als ein struktureller Bruch ist, findet hier eine fundierte, erhellende und gelegentlich ernüchternde Lektüre.