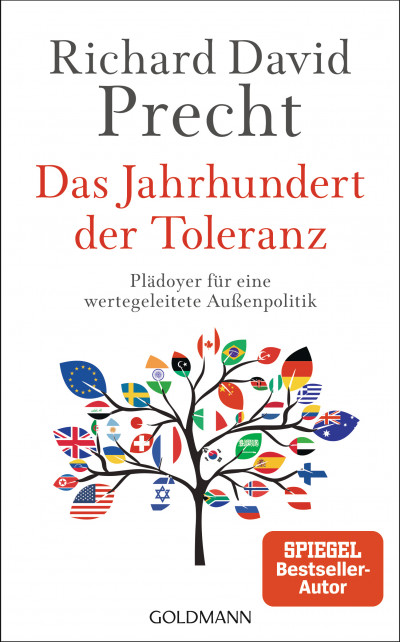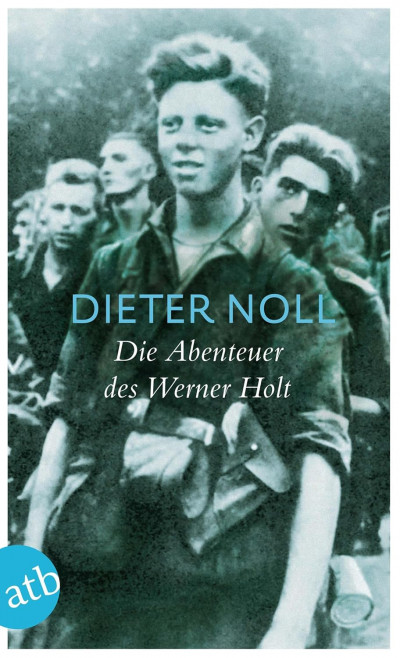Heute ist Ole Nymoen zu Gast bei Hart aber fair, wo es um die geplante Aufrüstung der Bundeswehr geht. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob höhere Verteidigungsausgaben angesichts globaler Bedrohungen notwendig oder Ausdruck einer zunehmenden Militarisierung sind.
Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde: Gegen die Kriegstüchtigkeit von Ole Nymoen
Eine Streitschrift gegen den Krieg oder ein naiver Pazifismus?
Ole Nymoen, bekannt für seine kritischen Analysen zur Influencer-Kultur und gesellschaftlichen Themen, begibt sich mit Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde: Gegen die Kriegstüchtigkeit (Rowohlt, 2025) auf das schwierige Terrain der Kriegs- und Wehrdienstdebatte. In einer Zeit, in der Kriegstreiberei wieder populär wird und patriotische Rhetorik zunehmend den politischen Diskurs dominiert, ist Nymoens Haltung ein provokanter, aber zugleich notwendiger Einwand.
Ein scharfer Einspruch gegen die Militarisierung
Mit nur 144 Seiten ist Nymoens Buch alles andere als eine umfassende Abhandlung. Es ist eine prägnante, polemische Intervention, die den Finger auf einen immer größer werdenden wunden Punkt der westlichen Gesellschaft legt: die Militarisierung des öffentlichen und politischen Lebens. Nymoen kritisiert die steigenden Verteidigungsausgaben, hinterfragt die Rhetorik der „Kriegstüchtigkeit“ und zeigt die Diskrepanz zwischen den Interessen des Staates und denen seiner Bürger auf. Was er als gefährlich empfindet, ist die Vorstellung, dass Patriotismus und die Bereitschaft zur Verteidigung eines Staates moralisch unantastbar seien.
Kriege, so Nymoen, entstehen nicht durch die freiwillige Entscheidung des Einzelnen, sondern durch staatlichen Zwang. Die Wehrpflicht und die gesellschaftliche Erwartung, in einem Verteidigungskrieg zu kämpfen, seien Formen der Kontrolle, die die individuelle Freiheit massiv einschränken. Nymoen plädiert für eine radikale Kriegsdienstverweigerung und eine pazifistische Haltung, die den Krieg als politische Lösung ablehnt.
Provokante Analysen und unbequeme Fragen
Nymoen stellt unbequeme Fragen. Wie gerecht kann ein „gerechter Frieden“ wirklich sein, wenn er nur mit Tausenden weiteren Toten erkauft wird? Wie viele weitere Opfer sind notwendig, um die Ziele eines Konflikts zu erreichen? Besonders in einer Zeit, in der sich der Westen zunehmend in geopolitischen Konflikten verstrickt, regt Nymoen dazu an, die wahren Kosten von Kriegen zu hinterfragen. Welche Ziele werden wirklich verfolgt, und welche Interessen stecken hinter der Propaganda, die den Krieg als unausweichlich darstellt?
Nymoen richtet seine Kritik nicht nur gegen undemokratische Regime, die ihre Bevölkerung zur Armee zwingen, sondern auch gegen die Demokratien, die eine moralische Pflicht zur Verteidigung propagieren. Dabei zielt seine Analyse besonders auf die steigenden Verteidigungsausgaben, die er als problematisch empfindet. Er plädiert für eine Abkehr von der militärischen Rhetorik und einen politischen Diskurs, der nicht dem Wohl des Staates, sondern dem Wohl der Menschen dient.
Ein zentrales Element seines Buches ist die persönliche Erzählung, die seine Argumentation untermauert. In einer eindrücklichen Szene schildert er einen Besuch auf dem Friedhof in Wierzbowo in einem polnischen Dorf, wo deutsche und russische Soldaten nebeneinander begraben liegen – junge Männer, die einander nie begegnet wären, hätten sie nicht für die Obrigkeit töten müssen. Diese Episode verleiht dem Buch eine emotionale Tiefe und macht den zentralen Gedanken greifbar: Im Krieg gibt es auf der Ebene der Bevölkerung nur Verlierer.
Auch die Rolle der Medien und der politischen Propaganda wird thematisiert. Nymoen beschreibt, wie sich Begriffe wie „Kriegstüchtigkeit“ schleichend in die Alltagssprache einschleichen, während die Bundeswehr gezielt über Social Media neue Rekruten anspricht. Hier zeigt sich sein scharfer Blick für die Mechanismen, die eine Gesellschaft auf Kriegskurs bringen. Besonders eindrucksvoll schildert er, wie Kriegsrhetorik durch Popkultur und Werbung normalisiert wird: Die Bundeswehr nutzt Social-Media-Influencer, um das Soldatendasein als eine Art Abenteuerreise zu inszenieren, während Kriegspropaganda sogar auf Popcorneimern im Kino auftaucht.
Gleichzeitig zeigt Nymoen auf, wie Pazifismus in der Öffentlichkeit zunehmend als Schwäche dargestellt wird. Kritiker von Aufrüstungspolitik werden als „Lumpen-Pazifisten“ verunglimpft, während ehemalige Kriegsgegner plötzlich zur Verteidigung der „Zeitenwende“ aufrufen. In diesem Kontext verweist er auf ein Zitat von Erich Maria Remarque: „Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hineingehen müssen.“ Dieses Zitat zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch und untermauert Nymoens These, dass Kriege vor allem von jenen befürwortet werden, die selbst nicht an die Front müssen.
Frieden kann nie einseitig sein
Kritiker werfen Nymoen vor, dass seine pazifistische Haltung zu einseitig sei. Der Vorwurf: sein radikaler Pazifismus ist in der Geschichte gescheitert. Schließlich kann eine Gesellschaft nur bestehen, wenn sie in der Lage ist, sich zu verteidigen. Wäre es nicht gerade in einer Demokratie notwendig, die Wehrfähigkeit aufrechtzuerhalten, um sich gegen äußere Bedrohungen zu schützen? Nymoens Thesen stoßen auf Widerstand bei jenen, die den nationalen Sicherheitsaspekt als unabdingbar betrachten.
Doch Nymoens Kritik zielt nicht nur auf eine ideale Welt, sondern stellt einen unaufgeregten Appell dar, der die geopolitischen Realitäten und die damit verbundenen nationalen Interessen hinterfragt. Er fordert ein Überdenken dessen, was der Staat von seinen Bürgern verlangt, und setzt sich mit der moralischen Berechtigung auseinander, in einen Krieg zu ziehen.
Ein provokantes Buch mit Diskussionsbedarf
Das Buch von Nymoen ist ein Mutmacher für die kritische Auseinandersetzung mit dem Militarismus und den politischen Dogmen der Gegenwart. Es spricht insbesondere jene an, die die militärische Rhetorik und die Kriegstreiberei als notwendig und moralisch gerechtfertigt betrachten. Nymoen fordert uns heraus, den Krieg nicht als Selbstverständlichkeit zu akzeptieren, sondern als das, was er ist: ein letzter Ausweg, der nur dann gezogen werden sollte, wenn alle anderen Optionen erschöpft sind.
In einer Zeit, in der die Diskussion über Krieg und Frieden zunehmend polarisiert, ist es entscheidend, auch die andere Seite der Medaille zu betrachten. Für Nymoen ist der größte Verlust in einem Krieg der Verlust von Menschenleben und der Verlust von moralischen Werten. Am Ende eines Krieges sind es immer die Zivilisten, die am meisten leiden, egal auf welcher Seite sie stehen.
Provokation, die zum Nachdenken anregt
Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde ist eine klare Buchempfehlung- gerade jetzt! Es ist ein Beitrag zur Diskussion über die Militarisierung der Gesellschaft, die politische Verantwortung und die moralische Haltung gegenüber Krieg und Frieden. Nymoen fordert uns auf, die gesellschaftliche Norm der Kriegstreiberei infrage zu stellen und eine pazifistische Haltung als ernsthafte Option zu betrachten. Es bleibt ein mutiger, aber auch polarisierender Beitrag zur aktuellen Debatte.
Über den Autor
Ole Nymoen, Jahrgang 1998, studierte Soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2019 analysiert er gemeinsam mit Wolfgang M. Schmitt in ihrem Podcast Wohlstand für Alle wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklungen. Neben seiner Tätigkeit als freier Journalist setzt er sich in seinen Publikationen kritisch mit zeitgenössischen gesellschaftlichen und ökonomischen Themen auseinander.