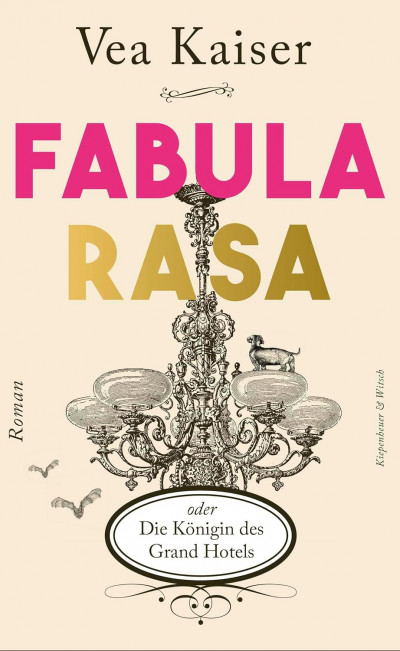Ein Ohrensessel. In der Gentzgasse. In Wien. Ein Schriftsteller sitzt und denkt. Oder besser: Er gerät in Erregung. Nicht äußerlich – sondern in jenem inneren, grammatisch ausgedehnten Zustand, den man nur bei Thomas Bernhard findet. Holzfällen. Eine Erregung spielt an einem einzigen Abend, in einem einzigen Raum, in einem einzigen Satz. Und gerade jetzt, in einer Zeit, in der jede Pose zur Haltung, jede Meinung zur Marke und jedes Gespräch zur Performance wird, liest sich diese Erregung wie ein seismografischer Roman über die Gegenwart.
Thomas Bernhards „Holzfällen“ – eine literarische Erregung, die nicht vergeht
Die Figuren heißen nicht wie reale Menschen – aber sie sind es beinahe. Die Auersbergers, einst Avantgarde, jetzt versteinert im Kunstbetrieb, laden zur Abendgesellschaft. Es gibt Brathuhn, Rotwein, Konversation. Und es gibt ihn – den Erzähler, den ehemaligen Freund, den Heimkehrer. Von einem Ohrensessel aus beobachtet er, was er längst kennt: die Rituale der Eitelkeit, die Selbstgewissheiten der Künstlergesellschaft, das große Theater der Mittelmäßigkeit.
Worauf gewartet wird: ein Schauspieler des Burgtheaters. Was geboten wird: ein Sprachsturm, ein seitenlanger Monolog, ein Kreisen um Zugehörigkeit und Abgrenzung. Der Erzähler zerschlägt die Anwesenden in Gedanken – und zerschlägt dabei sich selbst. Er will nicht dazugehören, aber er gehört dazu. Er verspottet, was er einmal war. Er zerlegt die Szene, die ihn geformt hat. Und mit ihr auch ihre Sprache: kunstgewordene Floskeln, Kunst als Karikatur, Kunst als Karneval.
Der Monolog als Maske
Bernhards Text ist kein Roman im traditionellen Sinn. Er ist eine Komposition. Ein einziger Satz, gegliedert durch Atempausen und Absätze, getragen von Wiederholung, Steigerung, Gegenrede. Es ist eine Rhetorik der Erschöpfung, ein Denken, das sich an sich selbst aufreibt. Der Erzähler verflucht Wien – und bekennt seine Liebe. Er hasst die Menschen – und gesteht ihre Rührung. Er lästert – und entlarvt sich selbst. Das Urteil ist scharf, aber nie stabil. Was wie Abrechnung klingt, ist auch Selbstanklage.
Denn das wahre Zentrum des Romans ist nicht die Gesellschaft, sondern der Erzähler. Er, der zurückgekehrt ist. Er, der schreibt, um zu verstehen, was sich nicht mehr erklären lässt. Das literarische Holzfällen, das dieser Text betreibt, ist auch eine Selbstzerstörung. In jedem Satz spiegelt sich die Ambivalenz: Die Kunst als Überhöhung – und als Lüge. Das Ich als Beobachter – und als Teil des Spektakels.
Eine Erregung, die bleibt
Holzfällen erschien 1984. Es folgten Prozesse, ein Verkaufsverbot, ein öffentliches Echo, das dem Titel alle Ehre machte. Die Gründe? Die Nähe zur Realität war zu scharf gezeichnet. Der Komponist Gerhard Lampersberg fühlte sich in der Figur des Herrn Auersberger erkannt und klagte – wegen Ehrenbeleidigung, wegen homosexueller Anspielungen, wegen literarischer Übergriffigkeit. Der Text wurde zur Affäre, zum Skandal, zum literarischen Menetekel.
Und doch – oder gerade deshalb – wirkt dieser Roman heute hellsichtig wie selten zuvor. Denn was Bernhard beschreibt, ist kein Einzelfall der Wiener Kulturgeschichte. Es ist eine Struktur. Ein Milieu. Ein System der gegenseitigen Bestätigung. Die Fragen, die er stellt, hallen bis heute nach: Wer darf urteilen? Was ist Kunst – und was ist nur deren Simulation? Wo endet das Ich – und wo beginnt das Kollektiv der Selbsttäuschung?
Der Ohrensessel als Weltmodell
Es ist fast schon eine Ironie der Form: Während der Ich-Erzähler sich im Text immer wieder auf denselben Sessel zurückzieht, gerät die Sprache in Bewegung. Der Ohrensessel wird zum Denkraum. Zum Gedächtnisspeicher. Zum Epizentrum einer literarischen Selbstverhandlung. Bernhard gelingt das Kunststück, den Stillstand der Handlung in eine Bewegung des Denkens zu verwandeln. Jeder Satz ist ein Schlag gegen die Oberfläche, jeder Einschub eine Brechung, jede Wiederholung ein Rücksturz in den Kreislauf der eigenen Argumente.
Gerade heute, wo Diskurse sich in Echtzeit verbrauchen und die Erregung oft schon simuliert ist, bevor sie sich ereignet, zeigt dieser Text, wie Literatur die Tiefe einer Erregung ausloten kann. Nicht als Pose, sondern als Verfahren. Nicht als Meinung, sondern als Form.
Kein Ausweg, aber ein Satz
Am Ende sitzt der Erzähler wieder auf dem Sessel. Der Schauspieler hat gesprochen, die Gäste haben gegessen, das Brathuhn ist vertilgt. Was bleibt? Ein Text, der kein Fazit zieht. Ein Monolog, der sich selbst nicht schont. Ein Roman, der zeigt, dass das, was wir Gesellschaft nennen, immer auch eine Bühne ist – und dass niemand wirklich den Raum verlässt, in dem er sich empört.
Bernhards Holzfällen ist keine Einladung. Es ist ein Spiegel. Ein hässlicher, präziser, rhythmisch geschliffener Spiegel. Wer hineinschaut, erkennt: sich selbst. Oder das, was man nie sein wollte. Oder beides.
Denn nur, was wir lieben, kann uns wirklich erregen. Und nur, was uns erregt, verdient es, beschrieben zu werden.
Topnews
Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Holzfällen. Eine Erregung“ – Thomas Bernhard im Gespräch: Wolfgang M. Schmitt und Achim Truger im Literaturforum im Brecht-Haus
Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)
Karen W. – Eine Resonanz des Alltags

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt

Johanna Hansen: SCHAMROT: Eine niederrheinische Kindheit
What’s With Baum? von Woody Allen
Salman Rushdie: Die elfte Stunde
Zwischen Licht und Leere. Eli Sharabis „491 Tage“ – ein Zeugnis des Überlebens
Thomas Brasch: Vor den Vätern sterben die Söhne
John Irving – Königin Esther
Vea Kaiser: Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels
Mein Name ist Emilia del Valle – Isabel Allende und der lange Atem der Herkunft
Wachs – Anatomie eines unaufgeregten Widerstands
Viktor Remizov: Permafrost
„Besinnt Euch!“ von Gerhart Baum
Aktuelles

Die Statue von Bernini
Patricia Vellard

Hassliebe von Tim Soltau
Tim Soltau
Morgan’s Hall: Ascheland von Emilia Flynn – Nach der großen Liebe kommt der Alltag
Morgan’s Hall: Niemandsland von Emilia Flynn – Wenn das „Danach“ gefährlicher wird als das „Davor“

Holger Friedel: Text über Zeit
Holger Friedel
Morgan’s Hall: Sehnsuchtsland von Emilia Flynn – Wenn Sehnsucht zum Kompass wird
Morgan’s Hall: Herzensland von Emilia Flynn – Wenn Geschichte plötzlich persönlich wird
Leipziger Buchmesse 2026: Literatur zwischen Strom, Streit und Öffentlichkeit
Wenn Welten kollidieren – Stephen Kings „Other Worlds Than These“ zwischen Mittwelt und Territorien

Sergej SIEGLE: Der Monolog
Sergej SIEGLE
Der andere Arthur von Liz Moore – Ein stilles Buch mit Nachhall

Am Strom
UpA
Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?
Das Blaue Sofa 2026 in Leipzig: Literatur als Gesprächsraum
Ostfriesenerbe von Klaus-Peter Wolf – Wenn ein Vermächtnis zur Falle wird
Rezensionen
Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag
Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort
Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?
Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen
Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel
Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird
Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird
Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet
Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend
The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst
Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage
Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit