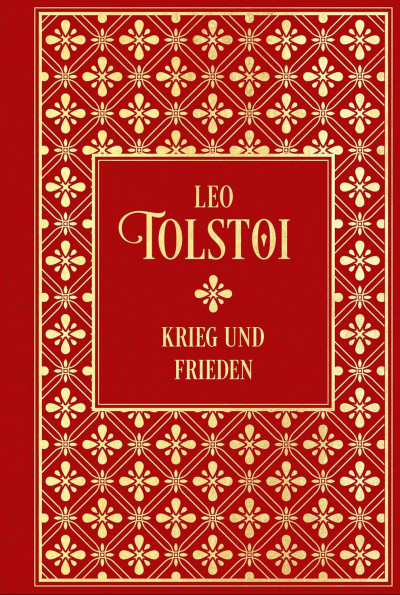Bonn, späte 70er: Abende in verrauchten Fraktionszimmern, Männer, die an Krawatten und Gewissheiten festhalten – und mittendrin eine Frau, die beides nicht nötig hat. Heike Specht lässt in „Die Frau der Stunde“ eine fiktive Liberale namens Catharina Cornelius in die höchste politische Umlaufbahn katapultieren: Außenministerin und Vizekanzlerin, 1978, in der Bonner Republik. Der Roman ist kein Kulissenstück, sondern ein Gedankenexperiment mit historischem Gespür: Wie sähe diese Epoche aus, wenn an einer neuralgischen Stelle eine Frau entschieden hätte? (Erstauflage Oktober 2025, Droemer Knaur.)
Handlung von „Die Frau der Stunde“
Catharina Cornelius, erfahrene Parlamentarierin, navigiert mit einer kleinen Frauen-Seilschaft – Freundinnen, Verbündete, Realistinnen – durch Bonns berüchtigten Sumpf aus Seilschaften, Altherrenwitzen und Presserunden. Als ein Skandal die Koalition erschüttert, greift die Partei zu einem riskanten Zug: Cornelius rückt nach – als Außenministerin und Vizekanzlerin. Was wie politisches Schach klingt, ist mehr als Taktik: Die Figur bekommt Entscheidungsräume, von denen Frauen in der realen damaligen Republik nur träumen konnten. Die erste Bewährungsprobe folgt umgehend: journalistische Häme, interne Abriegelung, offene Feindseligkeit – und außenpolitische Gemengelage, die nach neuen Antworten verlangt.
Specht erzählt den politischen Aufstieg nicht als Wunder, sondern als Arbeit: Aktennächte, Gesprächsdisziplin, Allianzen auf Zeit. Cornelius’ Privatleben bleibt Scharnier, nicht Dekoration: Wer Macht will, zahlt – in Schlaf, in Sicherheit, manchmal in Nähe. Der Roman lässt sie nicht als glatte Heldin glänzen, sondern als lernende Akteurin, die Zweifel hat und dennoch entscheidet. Und er spiegelt Bonns Innenwelt mit einer zweiten Bühne: den Folgen der Islamischen Revolution im Iran – besonders für Frauen. Das weitet die Perspektive: Freiheitsdebatten sind kein deutsches Monopol.
Machttechnik, Frauenbünde, Erzählmacht
Macht als Technik, nicht als Mythos: Specht seziert Sitzungsroutinen, Pressespiele und Sicherheitslogik. Die Frage ist nie romantisch („Darf sie das?“), sondern funktional: Was braucht es, um außenpolitisch handlungsfähig zu sein, wenn innenpolitisch die Legitimation permanent angezweifelt wird?
Frauen-Netzwerke als Gegenöffentlichkeit: Die „Clique“ um Cornelius ist keine schnurrige Teerunde, sondern ein strategisches Netzwerk. Sie trinkt Gin, ja, aber vor allem plant sie. Diese Solidarität verschiebt Balancepunkte – in Ausschüssen ebenso wie an Garderobenständern.
Medienblick & Chauvinismus: „Die Herren Journalisten spitzen die Feder“ – der Tenor ist überliefert, Specht macht ihn hörbar. Der Roman zeigt, wie Narrative männlich kodiert wurden: wenn Kompetenz als „Unsympathie“ gedeutet, Souveränität als „Kälte“ abgewertet wird. Das ist historisch plausibel und leider anschlussfähig an heutige Kommentarspalten.
Iran 1979 – der Spiegel: Die Einbindung der iranischen Umbrüche ist kein Exotik-Sidestory, sondern Kontrastfolie: Während Bonn am eigenen Chauvinismus knabbert, erleben Frauen im Iran einen Rechtsrückbau. Der Vergleich schärft Cornelius’ Entscheidungen – und zwingt Leser, Freiheit konkret zu denken.
Was wäre gewesen, wenn …
Der Clou ist die What-if-Frage: Hätte es 1978 eine Außenministerin/Vizekanzlerin gegeben, wäre die Tonlage der Republik eine andere gewesen? Specht verankert die Fiktion im Realen (Schmidt-Ära, Bonner Protokoll, Koalitionsarithmetik), ohne ins Doku-Drama zu kippen. Es entsteht ein Gegenwartsroman im Gewand der Vergangenheit: Lesbar als Ausbildungskurs in politischer Kultur – und als Kommentar zur Gender-Debatte im Politikbetrieb. Die Prämisse – Frau an der Schaltstelle, Koalitionsrettung, Reaktionen der Oppositions- wie Medienlandschaft – ist in den offiziellen Paratexten deutlich angelegt.
Tempo, Ton, Taktik
Specht schreibt zugänglich und rhythmisch: kurze bis mittlere Kapitel, Dialoge mit trockenem Witz und diese kleine literarische Kamera, die Orte arbeiten lässt (Ausschussräume, Flure, Parkett). In Beschreibungen schimmern Signaturender Zeit: Halstücher, Chignon, Rauch, ohne dass es je zur 70er-Jahre-Postkarte verkommt. Die Sprache hält Distanz, wenn es um Systeme geht, und wechselt auf Nahaufnahme, wenn es um Entscheidungsdruck oder die Freundinnengruppegeht. Genau diese Tonmischung – leicht lesbar, analytisch im Kern – macht den Roman erstaunlich zeitgenössisch. (Mehrere frühe Rezensionen heben die Lesbarkeit, manche auch die „sehr ausführlichen“ Passagen hervor.)
Für wen ist „Die Frau der Stunde“ geeignet?
-
Leser historischer Gegenwartsromane, die Politik nicht nur als Kulisse, sondern als Mechanik erleben wollen.
-
Zeitgeschichts-Interessierte (Bonn, Koalitionen, Medienlogik), die Lust auf ein kluges Gedankenexperimenthaben.
-
Buchclubs, die über Frauenbünde, institutionellen Sexismus und Außenpolitik diskutieren möchten – mit einer Figur, die mehr ist als Projektionsfläche.
Kritische Einschätzung – Stärken & Schwächen
Stärken
-
Relevantes „Was-wäre-wenn“: Die fiktive Ministerin öffnet den Blick auf reale Strukturen – ohne Lehrbuchgestus.
-
Doppelte Bühne: Bonn und Iran als Korrespondenzräume – macht die Bundesrepublik weniger selbstbezogen, die Außenpolitik konkret.
-
Netzwerk-Erzählung: Frauenfreundschaften als politisches Kapital, nicht als Nebenhandlung.
Schwächen (je nach Lesetyp)
-
Pacing: Biografisch anmutende Einschübe können die Spannung dämpfen – wer reinen Thrillerfluss erwartet, stolpert.
-
Heldenfolie?: Die gerechte Lust, eine kompetente Protagonistin zu zeigen, lässt Antagonisten bisweilen typisiert wirken.
-
Zeitkolorit: Die Liebe zum Detail (Mode, Rauch, Rituale) ist atmosphärisch stark, für Minimalisten vielleicht zu reich.
Kluges Gedankenexperiment, das heute trifft
„Die Frau der Stunde“ ist weniger Nostalgie als politische Fiktion mit Gegenwartsnerv. Specht zeigt, wie Macht gemacht wird – und wie fragil sie bleibt, wenn Strukturen dagegenhalten. Cornelius ist nicht makellos, aber arbeitsfähig, und genau das ist die literarische Pointe: Die Frau der Stunde ist nicht der rettende Engel, sondern eine professionelle Politikerin, die lernt, abfedert, führt. Wer literarisch hochgezogene Achseln gegenüber „Politik in Romanform“ hat, dürfte hier überrascht werden: Das ist unterhaltsam, fundiert und streckenweise sehr gegenwärtig.
Über die Autorin – Heike Specht
Heike Specht (Jg. 1974) ist Historikerin und Autorin (u. a. „Ihre Seite der Geschichte“ über die deutschen First Ladies; „Die Ersten ihrer Art“ über politische Pionierinnen). Sie promovierte über die Familie Feuchtwanger, arbeitete als Verlagslektorin und lebt heute in Zürich. „Die Frau der Stunde“ ist ihr Romandebüt – erschienen bei Droemer Knaur. Diese Mischung aus Archivblick und Erzählfreude erklärt, warum ihr Bonn so lebendig und recherchiert wirkt.
Leserfragen
Ist der Roman historisch korrekt – oder reine Fiktion?
Er ist fiktional, aber eng an der politischen Realität der späten 70er gespiegelt (Bonner Schauplätze, Koalitionslage, Medienklima). Das Buch kennzeichnet seine Fiktion transparent (alle Figuren erfunden), nutzt jedoch reale Ereignisse als Kontext, etwa die globalen Auswirkungen der Iranischen Revolution. So entsteht Plausibilität ohne Dokumentarzwang.
Wie politisch vs. wie persönlich ist die Erzählung?
Die Politik ist Motor – Sitzungen, Pressespiele, Entscheidungen – doch der Text bleibt nah an Cornelius’ Innenlebenund an der Freundinnengruppe. Das Private wird nicht privatisiert, sondern als Ressource und Risiko politischer Handlungsfähigkeit erzählt.
Für wen lohnt sich die Lektüre besonders?
Für Leser, die Zeitgeschichte mit starker Hauptfigur suchen; für alle, die wissen wollen, wie Frauenbünde in feindlichen Umgebungen funktionieren; für Clubrunden, die Gender, Medien und Außenpolitik gemeinsam denken wollen. Frührezensionen betonen Lesbarkeit und Zeitkolorit, einzelne kritisieren das gemächliche Pacing.
Hier bestellen
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Die Kryptografin von Hanna Aden – Codes, Courage und ein neues Deutschland
Der gefrorene Fluss von Ariel Lawhon – Eis, Recht und eine Frau, die Protokolle zur Waffe macht
Die stille Heldin von Hera Lind – Eine Mutter hält die Welt zusammen
Rabenthron von Rebecca Gablé – Königin Emma, ein englischer Junge, ein dänischer Gefangener:
Hiobs Brüder von Rebecca Gablé – Die Anarchie, acht Ausgestoßene und die Frage

Das zweite Königreich von Rebecca Gablé – 1066, ein Dolch aus Worten und der Preis der Loyalität
Tolstoi: Krieg und Frieden
Stonehenge – Die Kathedrale der Zeit von Ken Follett: Wenn Menschen den Himmel vermessen
Und Großvater atmete mit den Wellen von Trude Teige-Wenn Erinnerungen wie Brandung wiederkehren
Wir sehen uns wieder am Meer von Trude Teige: Drei Frauen, ein Krieg
Betrug von Zadie Smith: Hochstapler, Hausangestellte, Empire – ein viktorianischer Fall für die Gegenwart
Das Geschenk des Meeres von Julia R. Kelly: Schweigen, Schuld und das Flüstern der Tiefe
Atlas: Die Geschichte von Pa Salt – Der finale Band der „Sieben Schwestern“-Saga enthüllt das lang gehütete Geheimnis
Schach dem König. Friedrich der Große und Albert von Hoditz. Eine ungewöhnliche Freundschaft
Aktuelles
Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts
PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg
Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See
Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie
Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Tausende Stimmen für das Lesen: Weltrekordversuch in der MEWA Arena Mainz
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
Nachdenken einer vernachlässigten Sache
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
Rezensionen
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle