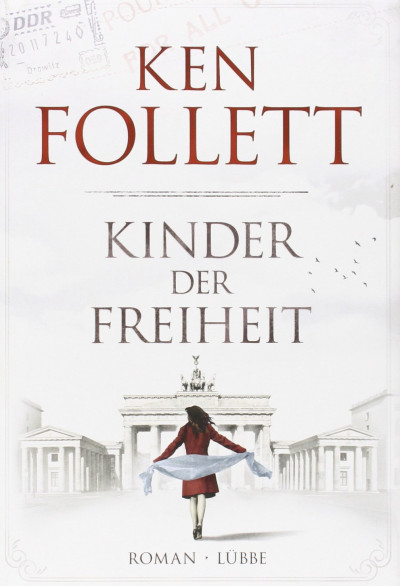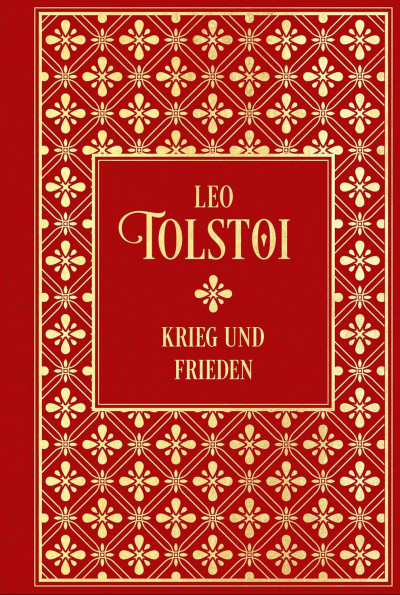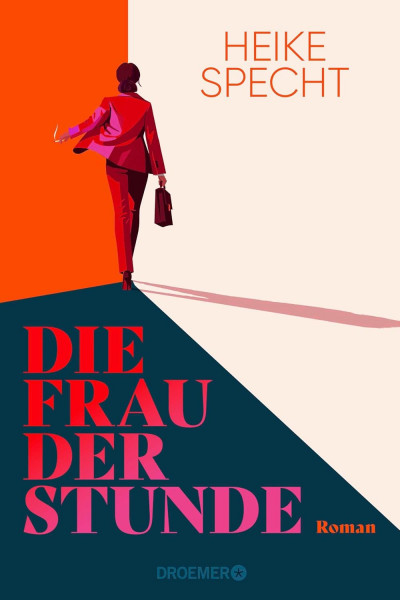Mit „Wir sehen uns wieder am Meer“ legt Trude Teige den dritten Teil ihrer viel diskutierten „Großmutter-Trilogie“vor – einen Roman über Freundschaft, Widerstand und Kollaboration im besetzten Norwegen sowie die Nachwirkungen bis in die Nachkriegszeit. Im Zentrum stehen Birgit, eine junge Krankenschwester, ihre Freundin Tekla(im Ort verächtlich als „Deutschenmädchen“ etikettiert) und die sowjetische Zwangsarbeiterin Nadia. Teige verknüpft reale Zeitgeschichte – von norwegischen Krankenhäusern im Norden bis zur norwegischen Botschaft in Moskau – mit persönlichen Schicksalen. Die deutsche Ausgabe erschien 2025 bei S. Fischer (Übersetzung: Günther Frauenlob).
Inhaltsangabe: Birgit 1944, eine riskante Freundschaft – und Entscheidungen mit langem Schatten
Norwegen, 1944: Birgit beginnt ihre Arbeit als Krankenschwester in einem von Besatzung und Mangel gezeichneten System. Dort begegnet sie Nadia, einer Zwangsarbeiterin aus der Sowjetunion, deren Lage Birgit nicht kaltlässt. Im selben Ort ringt Tekla um ihre Würde: Die Beziehung zu einem Deutschen macht sie zur Zielscheibe – ein Stigma, das mit Kriegsende nicht verschwindet. Zwischen Dienst, Gewissen und Gefahr verflechten sich die Wege der drei jungen Frauen.
Teige führt uns an Küstenorte und Krankenhäuser (u. a. Bodø) und öffnet später den Blick nach Moskau, wo Birgit als Dolmetscherin/Übersetzerin arbeitet. Über allem liegt die Frage: Welche Wahrheit ist sagbar – und zu welchem Preis? Die entscheidenden Enthüllungen und das spätere Schicksal der Figuren bleiben hier bewusst ausgespart; der Roman lebt davon, wie Loyalitäten geprüft werden und welche Entscheidungen die folgenden Generationen prägen.
Frauen in der Besatzungszeit, moralische Grauzonen, Erinnerungsarbeit
-
Unsichtbar gemachte Geschichte: Teige erzählt von Frauenbiografien, die im offiziellen Gedächtnis lange unterbelichtet blieben – von Pflegearbeit im Krieg bis zu Stigmata wie „Deutschenmädchen“. Der Roman macht sichtbar, wie soziale Etiketten Leben zerstören können.
-
Zwangsarbeit & Menschlichkeit: Die Begegnung mit sowjetischen Zwangsarbeitern öffnet einen Blick auf ein Kapitel, das auch in Norwegen weniger präsent ist – inklusive Lagerkrankheiten und unmenschlicher Arbeitsbedingungen.
-
Freundschaft als Widerstand: Zwischen Birgit, Tekla und Nadia entsteht eine Schicksalsfreundschaft, die nicht naiv ist, sondern risikobereit. Das Persönliche wird politisch – und umgekehrt.
-
Nachkriegswirklichkeit: Der Krieg endet, doch Scham, Schuld und Schweigen bleiben. Die berufliche Spur nach Moskau betont, dass Geschichte nicht am 8. Mai 1945 aufhört.
Besatzung in Norwegen, „Deutschenmädchen“ und sowjetische Zwangsarbeiter
Zwischen 1940 und 1945 war Norwegen von NS-Deutschland besetzt. Frauen, die Beziehungen zu deutschen Soldaten hatten – im Volksmund „Deutschenmädchen“ oder „tyskertøser“ – wurden nach dem Krieg häufig öffentlich gedemütigt; zugleich arbeiteten im Land Zwangsarbeiter, darunter viele Sowjetbürger, unter harten Bedingungen. Teige schreibt ausdrücklich „vom Kern wahrer Fälle inspiriert“ und stützt ihre Erzählung auf belegte historische Hintergründe – u. a. Krankenhäuser im Norden (z. B. Bodø) sowie diplomatische Stationen wie die norwegische Botschaft in Moskau.
Klar, empathisch, mit dokumentarischem Grundton
Teiges Prosa ist zugänglich, szenisch und verzichtet auf Pathos. Der Text arbeitet mit Zeitsprüngen und Perspektivwechseln, ohne die Orientierung zu verlieren. Typisch ist der leise, dokumentarische Grundton: Faktenhintergrund wird erzählerisch eingebettet – Lesende erfahren, verstehen und fühlen. (In der deutschsprachigen Resonanz wird genau diese Mischung aus Recherche und Erzählfluss gelobt.)
Für wen eignet sich der Roman?
-
Leser historischer Gegenwartsliteratur, die Frauenperspektiven jenseits des Frontgeschehens suchen.
-
Buchclubs, die über Kollaboration, Stigma, Zivilcourage und Vergebung sprechen wollen – der Roman liefert reichlich Diskussionsstoff.
-
Leser von Trilogien: Das Buch ist der dritte Band der „Großmutter-Trilogie“, lässt sich aber auch einzeln lesen. Wer die volle Fallhöhe will, profitiert vom Einstieg mit „Als Großmutter im Regen tanzte“ (Band 1).
Kritische Einschätzung – Stärken & mögliche Schwächen
Stärken
-
Relevanter Fokus: Teige rückt vergessene Kriegsschicksale (Zwangsarbeiter, „Deutschenmädchen“) ins Zentrum – informativ und empathisch.
-
Drei-Frauen-Achse: Die Freundschaft zwischen Birgit, Tekla und Nadia trägt die Handlung und macht Moral nicht schwarz-weiß, sondern verhandelbar.
-
Spannung aus Alltagsrisiken: Kein Action-Feuerwerk, sondern Druck aus Gerüchten, Dienstwegen, Mangel – genau das wirkt heutig.
Mögliche Schwächen
-
Erzählerische Taktung: Einzelne Rezensionen empfinden die Dramaturgie des Abschlussbandes als weniger straff als im Auftakt – die Botschaft überragt bisweilen den Plot-Sog.
-
Didaktik-Gefühl: Wo historische Hintergründe verdichtet werden, kann der Ton erklärend wirken – Geschmackssache.
-
Trilogie-Bindung: Ohne Vorwissen funktionieren Figuren und Motive, doch emotionale Bezüge entfalten sich stärker mit Kenntnis der früheren Bände.
Lese-Mehrwert: Gesprächsimpulse & Orientierung (kompakt)
-
Schuld & Stigma: Was geschieht, wenn eine Gemeinschaft moralische Urteile nach dem Krieg weiterträgt?
-
Zivilcourage im Kleinen: Welche Alltagshandlungen (ein Gespräch, eine Extrarasche im Dienst, ein Risiko) machen einen Unterschied?
-
Familienarchiv öffnen: Der Roman lädt dazu ein, eigene Familiengeschichten zu befragen – nicht zur Anklage, sondern zur Klärung.
Häufige FragenIst
„Wir sehen uns wieder am Meer“ Teil einer Reihe – und muss ich vorher etwas lesen?
Es ist der dritte Band einer lockeren Trilogie über verborgene Frauengeschichten im Zweiten Weltkrieg. Man kann den Band allein lesen; thematische und emotionale Bezüge vertiefen sich aber mit den Vorgängern.
Wie real sind die historischen Bezüge (Zwangsarbeit, „Deutschenmädchen“)?
Teige recherchiert an realen Schauplätzen und Motiven (u. a. sowjetische Zwangsarbeiter, Bodø-Krankenhaus). Das Buch ist fiktional, aber in belegter Geschichte verankert.
Warum ist der Roman in Deutschland so präsent?
Die Thematik trifft einen Nerv; der Band stieg schnell in die SPIEGEL-Bestsellerliste ein – nicht zuletzt, weil er verschüttete Kriegserfahrungen aus norwegischer Sicht beleuchtet.
Über die Autorin: Trude Teige – Journalistin, Erzählerin, Stimme vergessener Geschichte
Trude Teige (geb. 1960) ist eine der bekanntesten norwegischen Autorinnen. Sie arbeitete viele Jahre als Journalistin und TV-Moderatorin (u. a. bei TV 2) und ist für recherchestarke Romane bekannt, die Frauenperspektiven auf Krieg und Nachkrieg ins Licht rücken. Auf Deutsch erschienen u. a. „Als Großmutter im Regen tanzte“; „Wir sehen uns wieder am Meer“ setzt diesen Weg fort.
Lohnt sich „Wir sehen uns wieder am Meer“?
Ja – besonders, wenn du historische Romane mit Gegenwartsnerv suchst. Teige konkretisiert große Geschichte über individuelle Entscheidungen: Helfen, Wegsehen, riskieren. Dass der Abschlussband erzählerisch weniger „thrillig“ wirkt als der Auftakt, kann man kritisieren; zugleich liegt seine Stärke genau im stillen Ernst, mit dem er Stigma, Zwangsarbeit und Freundschaft verhandelt. Ergebnis: ein bewegender, diskussionsstarker Roman – ideal für Buchclubs und Leser, die Geschichte nicht abstrakt, sondern nah erleben möchten
Großmutter-Trilogie von Trude Teige – Kurzüberblick
-
Als Großmutter im Regen tanzte – Der Auftakt über verdrängte Kriegserfahrungen und ihre Folgen für drei Generationen.
-
Und Großvater atmete mit den Wellen– Die Geschichte von Konrad (dem Großvater) und Enkelin Juni: Wie Erinnerung und Schuld ans Ufer gespült werden.
-
Wir sehen uns wieder am Meer – Der Abschlussband über Birgit, Tekla und Nadia: Freundschaft, Zwangsarbeit und das lange Nachhallen des Krieges.
Hier bestellen
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Die stille Heldin von Hera Lind – Eine Mutter hält die Welt zusammen
Und Großvater atmete mit den Wellen von Trude Teige-Wenn Erinnerungen wie Brandung wiederkehren
Kinder der Freiheit - Taschenbuch erscheint im März
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Die Kryptografin von Hanna Aden – Codes, Courage und ein neues Deutschland
Der gefrorene Fluss von Ariel Lawhon – Eis, Recht und eine Frau, die Protokolle zur Waffe macht
Rabenthron von Rebecca Gablé – Königin Emma, ein englischer Junge, ein dänischer Gefangener:
Hiobs Brüder von Rebecca Gablé – Die Anarchie, acht Ausgestoßene und die Frage

Das zweite Königreich von Rebecca Gablé – 1066, ein Dolch aus Worten und der Preis der Loyalität
Kohlenträume von Annette Oppenlander – Überleben, Zwangsarbeit und eine verbotene Verbindung
Tolstoi: Krieg und Frieden
Die Frau der Stunde von Heike Specht – Bonn, Spätsommer, Zigarettenrauch
Stonehenge – Die Kathedrale der Zeit von Ken Follett: Wenn Menschen den Himmel vermessen
Nelio Biedermann („Lázár“): Warum alle über Biedermann reden
Betrug von Zadie Smith: Hochstapler, Hausangestellte, Empire – ein viktorianischer Fall für die Gegenwart
Aktuelles
Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts
PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg
Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See
Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie
Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Tausende Stimmen für das Lesen: Weltrekordversuch in der MEWA Arena Mainz
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
Nachdenken einer vernachlässigten Sache
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
Rezensionen
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle