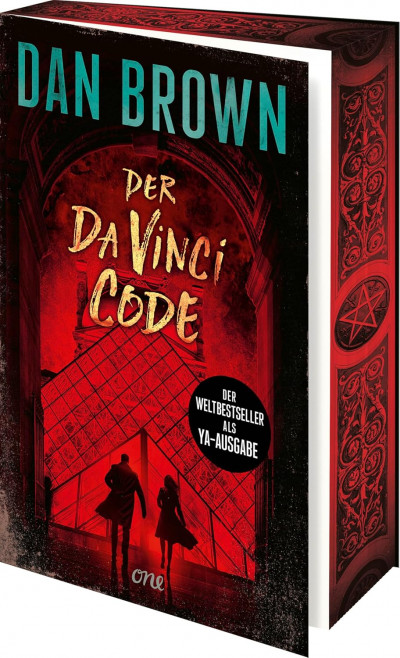Eine neue Wohnung am Berliner Stadtrand, frische Hoffnung, dünne Wände. Genau hier setzt Sebastian Fitzek mit „Der Nachbar“ an: Ein Psychothriller, der nicht in Kellern und Geheimlaboren spielt, sondern eine Wandstärke entfernt. Protagonistin Sarah Wolff, Strafverteidigerin, leidet an Monophobie – der Angst vor dem Alleinsein. Was wie ein persönliches Problem klingt, wird zum perfekten Einfallstor: Jemand in unmittelbarer Nähe nutzt ihre Verletzlichkeit aus. Der Roman erschien heute, am 22. Oktober 2025, als Hardcover (368 Seiten) bei Droemer.
Handlung von „Der Nachbar“
Sarah zieht mit ihrer Tochter an den Stadtrand von Berlin, will neu anfangen – mit Routinen, die Sicherheit geben. Ein hilfsbereiter Nachbar nimmt Pakete an, gießt Blumen, montiert ein Nachtlicht. Alles nett. Und doch: Der Ton kippt. Auf Fitzeks offizieller Buchseite wird klar, wohin die Reise geht: „unsichtbarer Nachbar“, keine Sekunde allein, das Unheimliche im engsten Umfeld. Mehr braucht es für die Grundspannung kaum, und mehr verrate ich nicht. Entscheidend ist die Dynamik: Sarahs Angst vor dem Alleinsein bringt sie dazu, Nähe bereitwillig zu akzeptieren – samt Einlass in ihr Privatestes. Genau daraus entsteht die Bedrohungsspirale, die den Roman treibt.
Gegenseite & Konflikt: Fitzek konfrontiert Sarah mit einer Präsenz, die nie direkt sichtbar sein muss, um wirksam zu sein. Für Lesende bedeutet das: Stalking-Logik auf Minimaldistanz – Flur, Zaun, Fensterbrett. Presse-Vorabberichte rahmen das Setting entsprechend: eine „freundliche“ Kontrolle, die zur Bedrohung mutiert.
Struktur: Wie gewohnt arbeitet Fitzek kapitelkurz mit Cliffhangern, Perspektivwechseln und Zeitsprüngen, die nach und nach ein Gesamtbild erzeugen. Das Ergebnis ist ein Scoreboard-Gefühl: jede Szene ein Punktgewinn oder -verlust in Sarahs Sicherheitskonto.
Themen & Motive – Nähe, Kontrolle, Wahrnehmung
1) Das Unheimliche im Normalen: Die Bedrohung entsteht nicht durch exotische Apparate, sondern durch Nachbarschaftsgesten: Hilfe anbieten, mal „kurz rüberkommen“, Schlüssel verwahren. Die vertraute Alltagskulissewird zur Waffe – und damit erschreckend plausibel.
2) Angst als Brandbeschleuniger: Monophobie ist hier kein Effekt, sondern Plotmotor. Wer nicht allein sein kann, sucht Verbindung – und macht sich angreifbar. Fitzek nutzt das psychologisch, nicht voyeuristisch: Wahrnehmung wird instabil, Vertrauen riskant.
3) Privatheit vs. Öffentlichkeit: Der Roman verhandelt die Frage, wo Hilfsbereitschaft endet und Zugriff beginnt. Damit berührt er aktuelle Debatten über Mikro-Überwachung im Alltag (Türkameras, Paket-Apps, Nachbarschaftsforen): Kontrolle muss nicht „Hightech“ sein, um total zu wirken.
4) Familienwunden: In Paratexten wird ein Kindheitstrauma angedeutet; Fitzek nutzt solche biografischen Risse traditionell als Resonanzraum, nicht als reinen Schock. Die Spannung speist sich also weniger aus Splatter, mehr aus moralischen und emotionalen Kosten. (Zeitungen charakterisieren den Band dennoch als besonders druckvoll – teils hart in der Darstellung.)
Warum der Stoff 2025 trifft
Die freundliche Dauerverfügbarkeit von Menschen in unserer Umgebung ist zum Standard geworden – Klingeln, Pingen, Teilen. Genau in dieses Netz greift „Der Nachbar“: Wer immer da ist, kann auch immer eingreifen. Medienberichte zum Erscheinungstag betonen den Reiz des scheinbar Harmlosen, das in Gefahr umschlägt – ein Muster, das unsere Gegenwart (vom Hausflur bis Social Media) gut kennt. Ergebnis: hoher Wiedererkennungswert, hohe Unruhe.
Fitzek-DNA: kurz, taktend, nah
Formal bekommen Fans, was sie erwarten: kurze Kapitel, Cliff-Enden, mehrere Blickwinkel und Tempowechsel. Der Buchtrailer setzt den Ton: Ein Satz als Mantra – „Sie dachte, ihre größte Angst sei es, allein zu sein – bis sie herausfand, dass sie es nie war.“ – und dazu Bilder aus Wohnungsnähe, nicht aus Katastrophenkulissen. Genau das erklärt den Sog: Fitzek dreht an Alltagsdetails (Schlüssel, Geräusche, Lampen), bis sie unheimlich klingen.
Für wen eignet sich „Der Nachbar“?
-
Für Psychothriller-Leser, die Real-World-Horror suchen: Wände, Türen, Flure – keine Hightech-Show.
-
Für Fitzek-Fans, die nach dem klassischen Mix aus Tempo + Twist greifen.
-
Für Buchclubs, die über Grenzen in Nachbarschaften, Hilfsbereitschaft vs. Kontrolle und den Umgang mit Angststörungen diskutieren wollen.
Stärken & mögliche Schwächen (ohne zu spoilern)
Stärken
-
Mikro-Setting, Maximaldruck: Das Konzept „Antagonist = Nebenan“ ist intuitiv und erzeugt konstante Anspannung – sehr „fühlbar“ beim Lesen.
-
Psychologischer Hebel: Monophobie als Antriebsfeder macht Sarahs Entscheidungen nachvollziehbar und liefert glaubwürdige Reibungen.
-
Pageturner-Handwerk: Cliff-Takt, Perspektivwechsel, präzise gesetzte Wendepunkte – klassische Fitzek-Architektur.
Mögliche Schwächen
-
Twist-Ökonomie: Bei hoher Taktung droht das Gefühl des „zu konstruiert“ – ein Punkt, den erste Pressestimmen branchenüblich anmerken. Entscheidend ist, ob die Spurlegung fair bleibt.
-
Härtegrade: Die WAZ spricht von „Hochspannung und Gewaltexzessen“ – je nach Lesetyp triggeranfällig. Starke Nerven sind kein Fehler.
-
Nähe als Exploit: Wer sehr sensibel auf Stalking/Übergriff reagiert, wird die Lektüre als Belastungsprüfungerleben – Thema und Anlage bedingen das.
Der Albtraum heißt: Nebenan
„Der Nachbar“ tut, wofür Psychothriller da sind: Er verschiebt die Sicherheitslinie dorthin, wo sie am meisten schmerzt – in die eigenen vier Wände. Fitzek braucht dafür keine Weltverschwörung, nur eine Tür, die zu oft offenstand, und einen Menschen, der Nähe als Macht versteht. Wer seine Bücher liebt, bekommt einen sehr fokussierten, alltagsnahenFitzek; wer grundsätzlich mit dem Genre hadert, wird sich hier kaum bekehren lassen – dafür ist die Methode zu bewusst „Fitzek“. Für alle anderen: hoher Sog, klare Haltung zum Thema Kontrolle, Diskussionsstoff für das echte Leben nach der letzten Seite.
Über den Autor – Sebastian Fitzek
Sebastian Fitzek (geb. 1971 in Berlin) gilt als erfolgreichster deutscher Psychothriller-Autor der Gegenwart. Bevor er schrieb, kam er aus dem Radiobetrieb: Jura-Studium, Promotion im Urheberrecht, anschließend Programmchef/Redaktionsleiter bei großen Sendern – diese Mischung aus Rechtsblick, Medienlogik und Timing prägt sein Spannungs-Handwerk bis heute.
Sein Debüt „Die Therapie“ (2006) wurde in Deutschland sofort ein Bestseller (berühmt der Anekdoten-Fakt, dass es „The Da Vinci Code“ von Platz 1 stieß) und begründete eine Werklinie, die Fitzek seither konsequent verfeinert: Alltagsnahe Settings, psychologische Grenzlagen, kurze Kapitel mit Cliff-Takt und späte, aber fair vorbereitete Twists. Seine Bücher sind inzwischen in über 36 Ländern erschienen und haben sich über 19 Millionen Mal verkauft.
Fitzek schreibt nicht nur für die Seite, sondern längst auch für Bühne und Bildschirm: Mehrere Stoffe liefen erfolgreich als Theateradaptionen (u. a. Der Seelenbrecher, Die Therapie, Passagier 23), und Prime Video startete 2023 die sechsteilige Serienfassung von „Sebastian Fitzeks Die Therapie“ (Weltpremiere 26. Oktober 2023). Der Autor pendelt damit souverän zwischen Buchmarkt, Live-Inszenierung und Streaming – ohne seine Markenzeichen aufzugeben: Tempo, Nähe, Alltag als Druckkammer.
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Der Augensammler Sebastian Fitzek – 45 Stunden, ein Killer mit Ritual und zwei Ermittler, die ihre eigenen Geister kennen
Playlist von Sebastian Fitzek – 15 Songs, ein vermisstes Mädchen, ein Wettlauf gegen die Zeit
Das Geschenk von Sebastian Fitzek | Psychothriller-Review
Sebastian Fitzek – Der Insasse: Spannung im Greenheights-Psychothriller
„Die Einladung“ von Sebastian Fitzek – Eine intensive Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche
„Mimik“ von Sebastian Fitzek – Psychothriller über Körpersprache, Manipulation und Identitätsverlust
Das Alptraumschiff mit Sebastian Fitzek
Die ewigen Toten von Simon Beckett – London, Staub, Stille: Ein Krankenhaus als Leichenschrein
Totenfang von Simon Beckett – Gezeiten, Schlick, Schuld: Wenn das Meer Geheimnisse wieder ausspuckt
Verwesung von Simon Beckett – Dartmoor, ein alter Fall und die Schuld, die nicht verwest
Leichenblässe von Simon Beckett – Wenn die Toten reden und die Lebenden endlich zuhören
Kalte Asche von Simon Beckett – Eine Insel, ein Sturm, ein Körper, der zu schnell zu Staub wurde
Die Chemie des Todes von Simon Beckett– Wenn Stille lauter ist als ein Schrei
Knochenkälte von Simon Beckett – Winter, Stille, ein Skelett in den Wurzeln
Der Da Vinci Code von Dan Brown – Schnitzeljagd durch Museen, Mythen und Macht
Aktuelles
Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte
Amazon-Charts – Woche bis zum 11. Januar 2026
„Druckfrisch“-Sendung vom 18. Januar 2026: Spiegel-Bestseller-Sachbuch
„Druckfrisch“ vom 18. Januar 2026
Literatur, die nicht einverstanden ist
Salman Rushdie bei der lit.COLOGNE 2026
Der Sohn des Wolfs – Jack Londons frühe Alaska-Erzählungen
Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher
Wolfsblut – Der Weg aus der Wildnis

Manfred Rath :In den Lüften
Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts
PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg
Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See
Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen
Rezensionen
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle