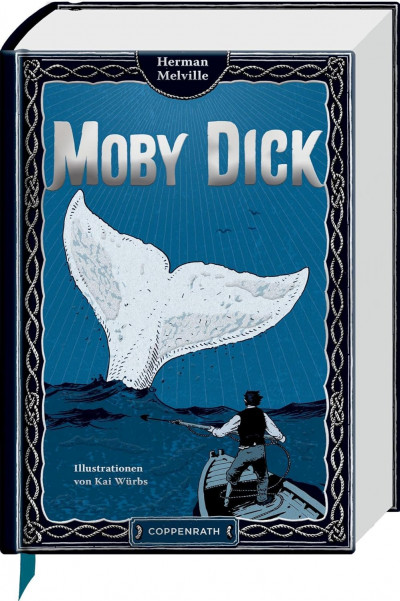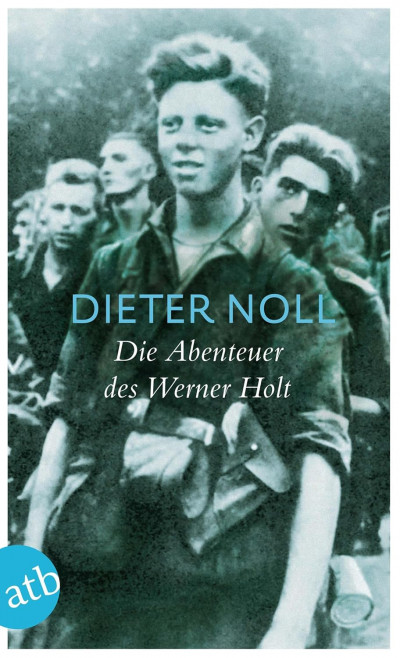Isaac Babels Geschichten aus Odessa gehören zu jenen Texten, bei denen man als Leser leicht in die Irre geführt wird – weil sie leichtfüßig wirken, manchmal sogar komisch, bisweilen sentimental. Doch unter der Oberfläche dieser scheinbar folkloristischen Miniaturen brodelt ein Abgrund: politisch, moralisch, stilistisch. Diese Erzählungen sind brutal ohne Pose, zärtlich ohne Kitsch, und so tief in der Sprache verankert, dass man aus dem Rhythmus der Sätze mehr über Macht und Ohnmacht lernt als aus einem Dutzend Romane.
Dass Babels Werk heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist, wirkt fast wie eine doppelte Tragödie – denn in den 1920er Jahren galt er als literarischer Shootingstar, der russischen Literatur ein neues jüdisches Gesicht verlieh: selbstbewusst, schillernd, unberechenbar.
Zwischen Gasse und Geist: Die Odessa-Geschichten als literarisches Vexierbild
Die Stadt selbst ist die eigentliche Hauptfigur: das jüdische Viertel Moldawanka, das gleichzeitig Ghetto und Bühne ist, Slum und Sehnsuchtsort. Hier herrscht Benja Krik, genannt „der König“, eine Mischung aus Volksheld, Gangsterboss und jüdischem Trickster. Sein Name – „Krik“, was im Russischen an „Schrei“ erinnert – trägt bereits das Versprechen von Lärm, Durchsetzungskraft und Exzess. Babel entwirft mit den Kriks ein jüdisches Gangstergeschlecht, das mit greller Kleidung, operettenhafter Gestik und einem anarchischen Sinn für Ordnung auftritt. Die Tochter trägt ihren Bräutigam lüstern ins Bett „wie eine Katze, die im Maul eine Maus trägt und sie sacht mit den Zähnen prüft“ – ein Satz, der die ganze Mischung aus Körperlichkeit, Humor und Gefahr in Babels Prosa bündelt.
Babel setzt der Märtyrer oder Opferrolle der jüdischen Darstellung in der russischen Literatur ein Ende. Seine Helden sind keine Waisenknaben – ihr Repertoire reicht von Brandstiftung und Erpressung bis zum Mord. Doch durch ihre halbseidene Eleganz, die manierliche Höflichkeit und die schimmernden, himbeerroten Hosen erscheinen selbst ihre Verbrechen in einem Licht karnevalistischer Leichtigkeit. Der Reiz dieser Gangsterprosa liegt im Sieg der Form über den Inhalt, in der Verführung durch den Stil – ein ästhetischer Trick, der Babels Werk einzigartig macht.
Vom Mythos zur Intimität
Die Odessa-Geschichten sind mehr als ein Zyklus um Benja Krik. Zwar bildet seine Figur einen narrativen Anker – ein König, der mit Gewalt und Charme regiert – doch Babel weitet seinen Blick rasch aus. Die Geschichten durchwandern unterschiedliche Milieus, Tonlagen und Perspektiven: von der Theatralik der Bandenwelt bis zur zärtlichen Miniatur über erste Liebe oder ein Kindheitserwachen im Keller. Die Sammlung entfaltet sich wie ein literarischer Fächer, der zugleich dokumentiert und dekonstruiert – das jüdische Leben, die Gesellschaft Odessas, und immer auch: die Erzählung selbst.
In manchen Texten dominiert die Groteske, in anderen eine fast stille Melancholie. Der Übergang von der öffentlichen Geste zur privaten Erinnerung erfolgt dabei nicht als Bruch, sondern als schleichender Drift. Es ist, als wolle Babel mit jeder neuen Geschichte das Bild, das er zuvor gezeichnet hat, noch einmal befragen – oder konterkarieren. Die Bandbreite reicht von zynischer Sozialkritik über impressionistische Porträts bis zur bitterkomischen Parabel.
Die englische Renaissance: Boris Dralyuks Übersetzung
Die 2016 erschienene englische Neuübersetzung von Boris Dralyuk hat den Geschichten eine neue Leserschaft erschlossen. Dralyuk gelingt es, Babels lakonischen Ton und dessen ganz eigene jüdische Sprachmusik ins Englische zu übertragen – rhythmisch, schnörkellos und dennoch voller Nuancen. In Rezensionen wurde sein Stil mit dem von Damon Runyon und Philip Roth verglichen – nicht zu Unrecht: Die Mischung aus Witz, Pathos und Präzision erzeugt einen Sog, der auch Leser erreicht, die wenig Vorwissen über das historische Odessa oder jüdische Kultur haben.
Besonders gelungen ist Dralyuks Fähigkeit, die Komik Babels nicht zu glätten. Die Geschichten sind „funny“, ja – aber es ist ein Humor, der aus den Ruinen spricht. Oder, wie es ein Rezensent treffend formulierte: „It’s about human beings and very, very funny with occasional bolts of pure pain.“
Schweigen als Widerstand
Dass Babel mit diesen Geschichten nicht nur einen literarischen, sondern auch einen politischen Drahtseilakt vollführte, zeigt sich in seinem weiteren Schaffen – oder vielmehr: in dessen Verstummen. Als Stalin die Literatur gleichschaltete, zogen sich viele Autoren ängstlich ins Schweigen zurück. Babel aber verwandelte dieses Schweigen in eine ästhetische Strategie. Auf dem Schriftstellerkongress 1934 erklärte er, er sei „der Meister einer neuen literarischen Gattung – der Gattung des Schweigens“. Ein Satz, der in seiner Ironie ebenso klarsichtig war wie tödlich. Fünf Jahre später wurde Babel vom NKWD verhaftet, gefoltert und schließlich erschossen. Seine Werke verschwanden aus Schulbüchern und Lexika – für Jahrzehnte.
Ohne Frage große Literatur
Geschichten aus Odessa ist literarische Verdichtung dessen, was Literatur leisten kann: Komplexität erzeugen ohne Überfrachtung, Komik entfalten ohne Harmlosigkeit, und Gewalt zeigen, ohne sie zu banalisieren. Babels Figuren reden, lieben, sterben und stehlen mit einer Würde, die nicht auf Moral zurückgeht, sondern aus innnerer Haltung.
Wer die Geschichten heute liest, sieht nicht nur eine untergegangene Welt – er sieht, wie Sprache als Überlebensmittel funktionieren kann. Das ist nicht nur „jüdisch“ – das ist menschlich, in seiner reinsten, tragikomischsten Form.
Topnews
Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Ich, Ljolja, Paris“ : Getäuscht von Juri Felsen
Moby-Dick – Melvilles grandioser Kampf zwischen Mensch und Mythos
Mary Shelley: Mathilda
Die Abenteuer des Werner Holt von Dieter Noll
Ein Haufen Dollarscheine von Esther Dischereit
Thomas Brasch: "Du mußt gegen den Wind laufen" – Gesammelte Prosa
Vom „Ritter Nerestan“ zu „Mädchen in Uniform“
Aktuelles