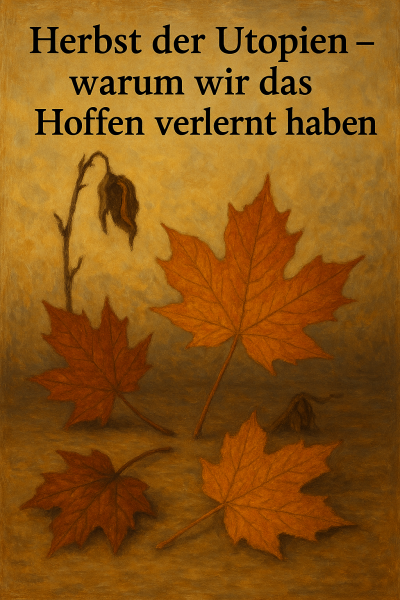Man sagt, Schriftsteller hätten kein Gespür für die Zukunft.
Sie sitzen in Cafés, rauchen zu viel und schreiben über Gefühle. Und doch sind sie es, die immer wieder das Unvorstellbare zuerst denken. Bevor Virologen über Reproduktionsraten sprachen, hatte Albert Camus schon seine Pest. Bevor Satelliten den Klimawandel fotografierten, malte J. G. Ballard in den 1960ern die überfluteten Städte der Zukunft.
Vielleicht ist Literatur deshalb das zuverlässigste Warnsystem der Moderne – eines, das wir notorisch überhören.
Pandemie als Probelauf der Fiktion
Als die Welt 2020 stillstand, griffen viele zu Camus’ Die Pest. Ein Roman aus dem Jahr 1947 wurde zum Sachbuch der Stunde. Aber nicht, weil er etwas „voraussagte“. Sondern weil er das Verhalten der Menschen in der Krise erkannte: das Bedürfnis, zu deuten, zu relativieren, zu verdrängen.
Camus’ Die Pest ist kein Katastrophenroman. Er handelt nicht vom Virus, sondern vom Blick, der es nicht sehen will. Die Pest kündigt sich langsam an – tote Ratten, Gerüchte, Statistiken. Doch nichts geschieht, weil niemand zuständig sein will. In dieser Trägheit liegt das eigentliche Drama: Die Katastrophe ist nicht der Bruch, sondern das langsame Wegsehen. Camus erzählt nicht von Heldentum, sondern von Protokollen, vom Ausharren, vom Schweigen. Arzt Rieux schreibt, weil er muss – nicht um zu retten, sondern um Zeugnis abzulegen. Es ist diese Haltung, die das Buch so beunruhigend aktuell macht: Es beschreibt keine ferne Bedrohung, sondern einen Zustand, in dem die Realität systematisch unterschätzt wird, bis sie nicht mehr ignorierbar ist. Wer Die Pest liest, erkennt nicht das Virus – sondern die Latenz, mit der Gesellschaft auf das Offensichtliche reagiert.
Auch jüngere Romane wie Ling Mas Severance oder Juli Zehs Über Menschen verarbeiten das, was Camus vorgezeichnet hat: Die eigentliche Krankheit ist nie nur biologisch. Sie ist sozial.
Klimafiktion: Die neue Dystopie
Kaum ein Thema hat die Gegenwartsliteratur so verändert wie die Klimakrise. Cli-Fi, wie das Genre etwas zu flapsig genannt wird, hat längst den klassischen Katastrophenroman abgelöst. Werke wie Kim Stanley Robinsons The Ministry for the Future oder Jenny Offills Wetter erzählen nicht vom Untergang, sondern vom Aushalten – vom Leben im „Noch“.
Interessant ist: Die besten dieser Romane sind keine Weltuntergangsdramen, sondern Protokolle der Alltäglichkeit. Keine Explosionen, sondern Erschöpfung. Keine Helden, sondern überforderte Menschen, die ihre Wasserflaschen zählen.
Warum Literatur das besser kann
Wissenschaft liefert Daten, Politik liefert Maßnahmen – aber Literatur liefert Bedeutung. Sie übersetzt Angst in Sprache, Chaos in Erzählung. Sie zwingt uns, uns selbst zu erkennen, bevor wir handeln.
Wenn man so will, ist jeder Roman, der uns unsere Gegenwart unheimlich erscheinen lässt, bereits eine Warnung. Der Rest ist nur Administration.
Das Versagen der Propheten
Das Bittere: Wir nehmen diese Warnungen selten ernst. Schon 1990 schrieb Margaret Atwood über Klimakatastrophen, in Oryx and Crake warnte sie vor Biotechnik und Überwachung. Heute liest man das als „Vision“. In Wahrheit war es längst Realität.
Vielleicht ist das Problem nicht, dass Schriftsteller zu früh warnen, sondern dass Leser zu spät reagieren.
Lesen als seismografischer Akt
Literatur kann Krisen nicht verhindern, aber sie kann sie spürbar machen. Sie ist kein Prognosemodell, sondern ein Empfindungsapparat. Wer liest, trainiert Wahrnehmung – und merkt, wenn der Boden bebt, bevor die Erde reißt.
Vielleicht liegt darin der eigentliche Sinn des Lesens in unruhigen Zeiten: Es ist nicht Eskapismus, sondern Frühwarnübung. Und manchmal reicht ein Satz, um die Zukunft zu hören, bevor sie passiert.
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Herbst der Utopien – warum wir das Hoffen verlernt haben
Ohne Frieden ist alles nichts
Stille Nacht, laute Welt – warum uns das Friedensmotiv in der Literatur nicht tröstet
Hörbücher, Hörspiele, Podcasts: Die Schmiermittel der unmündigen Gesellschaft
Albert Camus: "Die Pest" kommt als Miniserie
Aktuelles

Geschichte: Dilara Sophie Schömer

SIE von Claudia Dvoracek-Iby
Wiedersehen im Café am Rande der Welt von John Strelecky – Zurück an den Tisch, an dem das Leben Fragen stellt
Kairos von Jenny Erpenbeck– Liebe als Zeitversuch, Staat als Kulisse
To Cage a Wild Bird – Verlier dein Leben. Oder dein Herz von Brooke Fast

Lächelndes Mädchen: Pia Reichstein

Aus der Rolle fallen von Claudia Gehricke