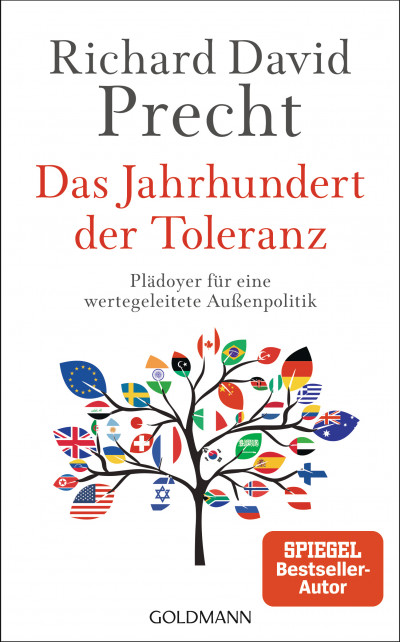Mit „Not Quite Dead Yet“ legt Holly Jackson nach ihren YA-Hits (A Good Girl’s Guide to Murder, Five Survive, The Reappearance of Rachel Price?) ihren ersten Roman für Erwachsene vor – und wählt dafür ein radikal simples, hochtouriges Konzept: Eine Frau hat sieben Tage Zeit, um den Mord an sich selbst aufzuklären, bevor er geschieht. Der Titel wurde als GMA Book Club Pick im August 2025 ausgewählt – ein Hinweis darauf, wie gut Jacksons Mischung aus Rätselspannung, Figurenfriktion und Gegenwartsbeobachtung auch im Erwachsenen-Segment funktioniert.
Not Quite Dead Yet von Holly Jackson:Thriller – Zeit läuft, Wahrheiten auch
Worum geht es in Not Quite Dead Yet: Jet Mason gegen die Uhr
Woodstock, Vermont. In der Halloween-Nacht wird Jet Mason, Tochter einer wohlhabenden Familie, in ihrem Elternhaus von hinten niedergeschlagen. Sie überlebt – knapp. Im Krankenhaus folgt die Diagnose: Ein Aneurysma wird sie innerhalb einer Woche töten, es sei denn, sie unterzieht sich einer extrem riskanten OP. Jet entscheidet anders: Ermitteln statt operieren. Zusammen mit Billy, dem loyalen Freund aus Kindertagen, rekonstruiert sie die Stunden vor der Tat, prüft Familie, Ex-Freund, Nachbarschaft – und stößt auf Risse zwischen Schein und Sein in einer Kleinstadt, die von Geld, Ansehen und Schweigen zusammengehalten wird.
Der Roman lebt weniger vom „Wer war’s?“ als von der Frage, wie Jet trotz schwindender Zeit, bröselndem Körper und halbwahrheitenreicher Umgebung zur belastbaren Wahrheit vordringt. (Ort, Diagnose, Figurenkonstellation und „Ticking-Clock“ sind durch Verlags- und Pressetexte belegt; konkrete Wendungen bleiben hier ausgespart.)
Sterblichkeit, Privileg, Deutungshoheit
-
Sterblichkeit als Plotmotor: Das Aneurysma macht jede Szene kostbar – Entscheidungen sind irreversibel, Zeit wird zur Währung. Jackson nutzt das Ticking-Clock-Motiv, ohne in bloße Action zu kippen; der Druck zwingt Jet, zwischen Selbstschutz und Wahrheitspflicht zu wählen.
-
Familie & Privileg: Woodstock steht für Status und Spaltung: reiche „alte“ Familien vs. alle anderen. Die Ermittlungen zerlegen Netzwerke aus Loyalitäten, Lügen und sozioökonomischen Gräben.
-
Erzählkontrolle: Polizei, Medien, Familienrat – wer bestimmt, was gilt? Jet ringt nicht nur mit Verdächtigen, sondern mit Deutungshoheit in einer Community, die Wahrung des Gesichts über Aufklärung stellt.
Kleinstadt-USA, Geld & Image
Jackson erdet die Geschichte in Vermonts Wohlstandslandschaft: Landhäuser, lokale Großunternehmer, Abhängigkeiten – ein Milieu, das Diskretion belohnt und Konflikte kaschiert. Gerade deshalb tragen Jets Schritte – nach außen sichtbar, nach innen polarisierend – eine gesellschaftliche Spannung: Wer darf Fehler machen, ohne dafür zu fallen? Wer profitiert davon, wenn die Version der Mächtigen wahr bleibt? Mehrere Besprechungen betonen dieses Klassen- und Image-Gefälle als Reibfläche der Handlung.
Scharfer Ton, dunkler Witz – und Tempo
Jackson erzählt nah an Jet: scharfzüngig, sarkastisch, mit dunklem Humor – eine Stimme, die Figuren wie Lesermal vor den Kopf stößt, mal mitreißt. Strukturell bleibt es straff: präzise gesetzte Hook-Enden, zügige Szenenwechsel und ein kontinuierlicher Erkenntnisgewinn. Kritiken loben den Sog, vermerken aber auch, dass Jets Tonfall zuweilen polarisiert.
Zielgruppe: Für wen funktioniert der Roman?
-
Leser*innen, die Krimi/Thriller mit klarer Prämisse und Zeitsog lieben.
-
Book-Clubs, die gerne über Privileg, Familienloyalität und moralische Grenzziehungen sprechen (die GMA-Auswahl zeigt die Diskussions-Tauglichkeit).
-
Fans von Jacksons YA-Büchern, die eine erwachsenere Tonlage suchen – ohne auf clevere Plot-Architektur zu verzichten.
Kritische Einschätzung
Stärken :
-
High-Concept mit Herz: „Sieben Tage, den eigenen Mord aufzuklären“ – starkes Konzept, getragen von Beziehungsdynamik (Jet & Billy) statt bloßen Twists.
-
Milieupräzision: Woodstock als Bühne für sozialen Druck macht Verdachtsmomente glaubwürdiger und die Auflösung bedeutsam.
-
Stimme & Drive: Jets bissiger Ton hält die Spannung hoch – gerade, wenn körperliche Grenzen enger werden.
Mögliche Schwächen:
-
Glaubwürdigkeitsgrenzen: Einzelne frühe Leser*innen/Rezensionen monieren medizinische/physischePlausibilität (wie viel eine frisch traumatisierte Figur leisten kann). Das Echo ist gemischt, der Pageturner-Effekt bleibt.
-
Figurenakzeptanz: Jets sarkastischer Zynismus kann distanzieren – bewusstes Risiko der Autorin.
-
Konzept-Dominanz: Wer klassische Whodunit-Überraschungen erwartet, bekommt eher ein „Whydunit/Howcatchem“ mit stetem Druck als mehrfachen Perspektiv-Zauber.
Lohnt sich „Not Quite Dead Yet“?
Ja. Jackson übersetzt ihre YA-Stärken – cleveres Plotten, klare Spannungspunkte, prägnante Stimme – überzeugend ins Erwachsenen-Fach. Der Roman ist schnell, bissig und thematisch zeitnah (Geld, Image, Loyalität). Wer mit einer Protagonistin leben kann, die nicht gefallen will, bekommt einen Thriller, der Nerv und Nachhall verbindet.
Über die Autorin: Holly Jackson – vom YA-Phänomen zum Adult-Thriller
Holly Jackson (geb. 1992) ist britische Autorin und wurde mit der Reihe „A Good Girl’s Guide to Murder“international bekannt; es folgten u. a. „Five Survive“ und „The Reappearance of Rachel Price?“. „Not Quite Dead Yet“ ist ihr Adult-Debüt. Ihre Bücher erscheinen in Dutzenden Sprachen; im deutschsprachigen Raum betreut u. a. Bastei Lübbe die Veröffentlichungen.
Drei Fragen, die sich beim Lesen stellen
Wie nutzt Jackson das „Ticking-Clock“-Motiv, ohne Logikopfer zu bringen – und wo liegt die Plausibilitätsgrenze?
Die Uhr zwingt Jet zu harten Prioritäten statt zu Superkräften: weniger Nebenstränge, mehr direkte Konfrontationen. Grenze ist erreicht, wenn ihre medizinische Lage objektiv unmögliche Belastungen erlaubt oder Beweise „zufällig“ zur rechten Zeit auftauchen.
Ist Jet „sympathisch“ – oder als widersprüchliche Figur spannender?
Ihre Widersprüchlichkeit trägt den Reiz: bissig, verletzlich, manchmal unfair. Nicht „nett“, aber glaubwürdig – und genau deshalb als Erzählerin packend.
Welche Rolle spielt Privileg für Schuld, Ermittlungszugang und Glaubwürdigkeit in Woodstock?
Status öffnet Türen (Informationen, Schonraum), schützt aber auch Täter:innen durch Netzwerke und Imagepflege. Wer wenig Kapital hat, gilt schneller als unglaubwürdig – und braucht härtere Beweise, um gehört zu werden.
Hier bestellen
Topnews
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Leichenblässe von Simon Beckett – Wenn die Toten reden und die Lebenden endlich zuhören
Kalte Asche von Simon Beckett – Eine Insel, ein Sturm, ein Körper, der zu schnell zu Staub wurde
Die Chemie des Todes von Simon Beckett– Wenn Stille lauter ist als ein Schrei
Knochenkälte von Simon Beckett – Winter, Stille, ein Skelett in den Wurzeln
Biss zum Ende der Nacht von Stephenie Meyer – Hochzeit, Blut, Gesetz: Der Schlussakkord mit Risiken und Nebenwirkungen
Das gute Übel. Samanta Schweblins Erzählband als Zustand der Schwebe

Biss zum Abendrot von Stephenie Meyer – Heiratsantrag, Vampirarmee, Gewitter über Forks

Biss zur Mittagsstunde von Stephenie Meyer – Wenn Liebe schweigt und Wölfe sprechen
Biss zum Morgengrauen von Stephenie Meyer – Erste Liebe im Dauerregen: Warum dieser Vampirroman bis heute wirkt
Crushing von Genevieve Novak – Millennial-Herz, Dating-Chaos, Humor als Selbstschutz
Maybe in Another Life von Taylor Jenkins Reid – Eine einzige Entscheidung, zwei Lebensläufe
„Die Leber wächst mit ihren Aufgaben – Komisches aus der Medizin“ von Eckart von Hirschhausen
Der große Sommer von Ewald Arenz– Ein Sommer, der vom Schwimmbad aus die Welt erklärt
Paradise Garden von Elena Fischer– Sommer, Nudeln mit Ketchup und der Moment, der alles teilt
Gespenster denken nicht – Shakespeares Hamlet als Gedankenreise durch ein zersetztes Drama
Aktuelles

Jessica Ebenrecht: Solange wir lügen
Weihnachten in Bullerbü– Astrid Lindgrens Bullerbü als Bilderbuch
Leichenblässe von Simon Beckett – Wenn die Toten reden und die Lebenden endlich zuhören
Kalte Asche von Simon Beckett – Eine Insel, ein Sturm, ein Körper, der zu schnell zu Staub wurde

Katja Niemeyer: Vergangenes bleibt – in Wandlung
Jostein Gaarders: Das Weihnachtsgeheimnis

Joëlle Amberg: Wieso
What’s With Baum? von Woody Allen
Briefe vom Weihnachtsmann von J. R. R. Tolkien

Juliane Müller: Eine WG mit der Trauer
Die Chemie des Todes von Simon Beckett– Wenn Stille lauter ist als ein Schrei

Katrin Pointner: Mein Land
Georgi Gospodinovs „Der Gärtner und der Tod“ ist Buch des Jahres der SWR Bestenliste
Die SWR Bestenliste als Resonanzraum – Zehn Texte über das, was bleibt
Knochenkälte von Simon Beckett – Winter, Stille, ein Skelett in den Wurzeln
Rezensionen
Biss zum Ende der Nacht von Stephenie Meyer – Hochzeit, Blut, Gesetz: Der Schlussakkord mit Risiken und Nebenwirkungen
Das gute Übel. Samanta Schweblins Erzählband als Zustand der Schwebe

Biss zum Abendrot von Stephenie Meyer – Heiratsantrag, Vampirarmee, Gewitter über Forks