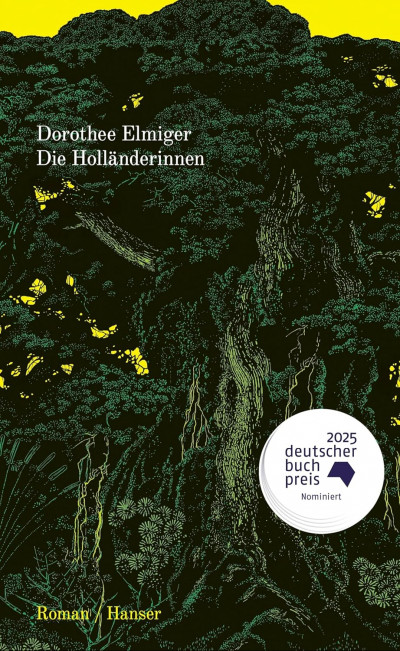Erik Larson, bekannt durch „The Devil in the White City“, verknüpft in „Der Teufel von Chicago“ (Originaltitel The Devil in the White City, 2003, dt. 2004) den glanzvollen Bau der Weltausstellung 1893 mit den unvorstellbaren Untaten des Serienmörders H. H. Holmes. Larson entwirft eine duale Erzählung: Auf der einen Seite die beeindruckende Ingenieurskunst der „White City“, auf der anderen Seite das düstere Mordimperium eines Mannes, der seine Opfer in einem eigens konstruierten „Mordschloss“ ermordete und ausweidete. Diese Rezension im Lesering-Stil beleuchtet Larsons Erzähldynamik, die zentralen Motive, den gesellschaftlichen Kontext, Sprachstil, Zielgruppe und die bleibende Faszination dieses True-Crime-Klassikers.
Handlungsüberblick: Triumph und Terror im Schatten der Weltausstellung
Larson wechselt kapitelweise zwischen zwei Protagonisten: Daniel Burnham, dem Architekten der Weltausstellung, und H. H. Holmes, einem scheinbar charmanten Arzt, der in Chicago sein mörderisches Werk entfaltet. Burnham kämpft gegen Zeitdruck, Finanzierungsprobleme und den amerikanischen Winter, um die architektonische Ikone zu vollenden. Parallel dazu lockt Holmes ahnungslose Besucher in sein elaboriertes Spukhaus, ein Labyrinth aus verborgenen Gängen und vergifteten Gasleitungen. Larson beschreibt minutiös, wie Holmes Opfer strangulierte, vergiftete oder lebendig verbrannte, um an deren Versicherungsimpfopfährige Entschädigungen zu kassieren.
Fortschrittsglaube, Abgründe und die Maske des Bösen
-
Dualität von Aufbruch und Verfall: Die Prachtbauten der Weltausstellung symbolisieren Fortschrittsglaube, während Holmes’ Machenschaften die dunkle Seite der Moderne enthüllen.
-
Maskerade und Täuschung: Holmes‘ Fassade als angesehener Arzt verdeutlicht, wie leicht soziale Konventionen Mörder schützen können.
-
Kapitalismus und Profit: Larson zeigt die Obsession mit monetären Gewinnen – von Ausstellungstickets bis zu Versicherungsbetrug – und wie Geld Verderben beschleunigt.
-
Massenhysterie und Medien: Presseberichterstattung und Sensationsjournalismus befeuern sowohl den Ruhm der Ausstellung als auch die Legendenbildung um Holmes.
Gilded Age, Industrialisierung und urbanes Trauma
Die Weltausstellung von 1893 fällt in die amerikanische Gilded Age-Ära, geprägt von rasantem Wachstum, sozialer Ungleichheit und technologischen Durchbrüchen. Chicago avanciert zur Metropole, doch gleichzeitig breiten sich Armut und Kriminalität aus. Larson verknüpft historische Fakten – wie den Aufstieg von Electric Light und Stahlarchitektur – mit sozialen Abgründen: Arbeiterelend, Korruption und das Aufbrechen traditioneller Gemeinschaften. In dieser Milieuzeichnung wird Holmes’ Verbrechen zur Allegorie auf die Schattenseiten der Moderne.
Historischer Roman trifft journalistische Präzision
-
Wechselnde Perspektiven: Larsons Kapitelmontage wechselt zwischen Drama (Ausstellung) und Horror (Holmes), was stetig Spannung erzeugt.
-
Detailverliebte Recherche: Originaldokumente, Tagebücher, Gerichtsprotokolle und Zeitungsartikel verweben sich zu einem lückenlosen, dennoch lesefreundlichen Protokoll.
-
Narrative Bildsprache: Szenen wie das Flammenmeer über dem Ausstellungsgelände oder die klaustrophobischen Räume von Holmes‘ Hotel wirken filmisch intensiv.
-
Reflektive Einschübe: Larson kommentiert technische und gesellschaftliche Hintergründe mit ironischem Unterton, ohne den Lesefluss zu stören.
Wer sollte „Der Teufel von Chicago“ lesen?
-
True-Crime-Leser*innen, die historische Serienmörder in epischer Breite studieren möchten.
-
Geschichtsinteressierte, die die Weltausstellung 1893 und die Gilded Age verstehen wollen.
-
Architektur- und Technikbegeisterte, die sich für den Bau von Großprojekten vor mehr als einem Jahrhundert begeistern.
-
Feuilleton-Fans, die literarischen Non-Fiction-Stil und investigative Tiefe schätzen.
Stärken & Schwächen
Stärken:
-
Fesselnde Dualstruktur, die Fortschrittsoptimismus und mörderische Perversion simultan darstellt.
-
Narrative Klarheit, trotz komplexer historischer und kriminalistischer Informationen.
-
Gesellschaftskritische Dimension, die Kapitalismus und Sensationslust seziert.
Schwächen:
-
Langer Umfang, der Gelegenheitsleser abschrecken könnte.
-
Emotionaler Abstand, Larson bleibt oft analytisch und gewährt weniger empathische Einblicke in Opferperspektiven.
Ein literarisches Monument zwischen Bewunderung und Grauen
„Der Teufel von Chicago“ fasziniert durch die Gegenüberstellung von Erfindergeist und abgrundtiefem Verbrechen. Erik Larson liefert ein packendes Zeitporträt und eine makabre True-Crime-Erzählung in einem. Wer die dunklen Ecken der amerikanischen Moderne erkunden will, findet hier ein Bestseller-Meisterwerk.
Über den Autor: Erik Larson im Fokus
Erik Larson, geboren 1954, ist ein US-amerikanischer Journalist und Bestsellerautor. Mit „Der Teufel von Chicago“ und „Der Dampfwagenfahrer“ prägte er das Genre der literarischen Non-Fiction. Larson lebt in Maryland und forscht unermüdlich in Archiven, um historische Fäden zu modernen Narrativen zu knüpfen.
Leserfragen zu „Der Teufel von Chicago“
1. Welche historischen Quellen nutzt Larson?
Er stützt sich auf Ausstellungstagebücher, Architektenpläne, Gerichtsakten und Zeitungsarchive.
2. Wie realistisch ist Holmes‘ „Mordschloss“?
Larson belegt dessen Existenz durch Stadtpläne und Zeugenaussagen, warnt aber vor Übertreibungen in Legendenbildung.
3. Welche Rolle spielen Medien und Sensationsjournalismus?
Presseberichte steigerten die Besucherzahlen der Ausstellung und erweiterten gleichzeitig Holmes’ Mythos.
4. Ist der historische Kontext gut verständlich?
Larson erklärt Industrieprozesse und soziale Umwälzungen prägnant, ohne Fachjargon zu nutzen.
5. Für wen lohnt sich die Lektüre besonders?
Für alle, die True Crime als gesellschaftliches Spiegelbild und literaturgewordene Chronik der Moderne sehen.
Hier bestellen
Topnews
Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson
Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren
Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag
Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge
Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe
Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Die Holländerinnen von Dorothee Elmiger – Aufbruch ins Offene: Wenn True Crime zur Fata Morgana wird
Kein Hauch von Wahrheit von Lisa Jewells: Podcasterin trifft „Birthday Twin“ – und alles kippt

Mr Nice von Howard Marks: Aufstieg des Haschisch-Königs & wahre Hintergründe
I’ll Be Gone in the Dark – Michelle McNamaras eindringliche Analyse des Golden State Killer-Falls
Gnadenlos: Das Lied vom Henker: Norman Mailers literarisches Verhör der amerikanischen Gewissensfrage
Im Schatten des Zodiacs: Robert Graysmiths packende Spurensuche
"Helter Skelter" von Vincent Bugliosi – True Crime auf dem Seziertisch der Justiz
„Kaltblütig“ von Truman Capote – Der erste True-Crime-Roman der Literaturgeschichte
True Crime Romane: 7 Bücher, die auf echten Verbrechen basieren
Aktuelles
Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land
Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee
Der König von Narnia von C. S. Lewis – Durch den Pelzmantel in die Ethik
Das Wunder von Narnia von C. S. Lewis – Wie aus einer Kinderspielerei eine Welt entsteht
The Dog Stars von Peter Heller – Eine Endzeit, die ans Herz greift, nicht an den Puls
Sturmhöhe von Emily Brontë – Liebe als Windbruch
Kurs halten, Markt sichern: Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef
Primal of Blood and Bone – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Der Blick nach vorn, wenn alles zurückschaut
Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird
War and Queens – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn Gefühle zum Kriegsgerät werden
Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne
Goethe in der Vitrine – und was dabei verloren geht Warum vereinfachte Klassiker keine Lösung, sondern ein Symptom sind
Leo Tolstoi: Anna Karenina
Zärtlich ist die Nacht – Das leise Zerbrechen des Dick Diver
Kafka am Strand von Haruki Murakami
Rezensionen
Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein
Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte
Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird
Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen
Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht
Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen
Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut
To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht
To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen
Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle