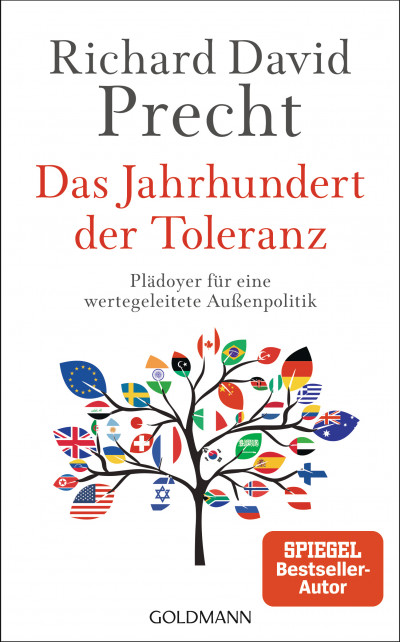Die Jury der "Sprachkritischen Aktion" hat den Begriff "Klimaterroristen" zum Unwort des Jahres 2022 gewählt. Die Aktivisten, so heißt es in der Begründung, würden mit dieser Bezeichnung "kriminalisiert und diffamiert"
Zu Beginn des 20. Jahrhundert notiert der Lyriker Gottfried Benn den Satz: "Die deutsche Form der Revolution ist die Denunziation". 2015, keine hundert Jahre später, heißt es auf dem K.I.Z. Album Hurra die Welt geht unter: "Ich habe noch nie so treue Sklaven gesehen, die bereit sind für mehr Arbeit auf die Straße zu gehen". Sieben Jahre später, im Jahr 2022, reißen Autofahrer Klimaaktivisten von den Straßen mit der Begründung, sie müssten zur Arbeit. Etwas lapidar: Die deutsche Form der Revolution scheint sich heutzutage in der Sicherstellung der Fortführung der gewissenlosen Konsumtion auszudrücken. Wütend wird man dort, wo die Arbeitszeit - wohlgemerkt nicht einmal der Arbeitsplatz, lediglich die Arbeitszeit! - bedroht ist. Das Argument der deutschen Revoluzzer - wenn da täglich irgendjemand im Weg sitzt und so die Produktionswege unterbricht, dann kann das alles nicht mehr so weitergehen wie bisher - ist quasi nichts anderes als die Wiederholung der Aufforderung, mit der die Klimaaktivsten die Straßen blockieren. Mit dem deutschen Geist ist es also auch nicht mehr so weit her.
"Klimaterroristen"
Das Freischaufeln der lieb gewonnenen Arbeitswege jedenfalls, wurde von diversen Begriffen flankiert, von denen es nun einer zum "Unwort des Jahres" geschafft hat. Als "Klimaterroristen" hatte man die AktivistInnen bezeichnet. Die "Sprachkritische Aktion", die jährlich das "Unwort" wählt, begründet ihre Entscheidung unter anderem damit, dass der Ausdruck "Klimaterroristen" die AktivistInnen und deren Protest öffentlich diskreditiert. Man beziehe im öffentlich-politischen Diskurs pauschal Bezug auf Akteure, "die sich für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens einsetzen."
"Die Jury kritisiert die Verwendung des Ausdrucks, weil Klimaaktivist:innen mit Terrorist:innen gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert werden", so die Jury weiter. "Unter Terrorismus ist das systematische Ausüben und Verbreiten von Angst und Schrecken durch radikale physische Gewalt zu verstehen. Um ihre Ziele durchzusetzen, nehmen Terrorist:innen dabei Zerstörung, Tod und Mord in Kauf. Durch die Gleichsetzung des klimaaktivistischen Protests mit Terrorismus werden gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt."
Die BILD und die "Klima-Kleber"
Als weitere Begriff mit ähnlicher Ausrichtung nennt die Jury Klimaterrorismus, Ökoterrorismus und Klima-RAF. Letzterer war vornehmlich in konservativen bis reaktionären Kreisen zu vernehmen, wo man sich vermutlich nach einem Genger mit klaren Konturen sehnt, um die eigene Position untermauern zu können. Medial hatte sich die BILD-Zeitung als "Klima-Kleber"-Gegner-Blatt hervorgetan, wobei der Begriff "Klima-Kleber" im Zuge der "Berichterstattung" so häufig fiel, dass er die vom Freiräumen der Straßen vollkommen erschöpfte Leserschaft bis in die Träume hinein verfolgt haben muss. Dass der Begriff "Klima-Kleber" - ähnlich wie die Scholz-Vokabeln "Doppel-Wumms" und "Bazuka" - gewissermaßen auch auf das geistige Alter der damit Adressierten verweist, hatte man im Wiederholungswahn wohl außer Acht gelassen.
"Sozialtourismus" und "defensive Architektur" auf Platz 2 und 3 auf der "Unwörter"-Liste
Auf Platz 2 der "Unwörter"-Liste wählte die Jury den von Friedrich Merz wiedergebrachten Begriff "Sozialtourismus". Hierzu heißt es in der Begründung: "Der Ausdruck Sozialtourismus war bereits 2013 Unwort des Jahres. Von einigen Politiker:innen und Medien wurde damals mit der Verwendung dieses Wortes gezielt Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderung, insbesondere aus Osteuropa, gemacht. Aus aktuellem Anlass hat sich die Jury entschieden, diesen Ausdruck auf Platz 2 zu setzen. Im Jahr 2022 wurde Sozialtourismus von Friedrich Merz zur Bezeichnung von Menschen aus der Ukraine, die Zuflucht vor dem Krieg suchen, verwendet. Die Jury sieht in diesem Wortgebrauch eine Diskriminierung derjenigen Menschen, die vor dem Krieg auf der Flucht sind und in Deutschland Schutz suchen; zudem verschleiert der Ausdruck ihr prinzipielles Recht darauf. Die Perfidie des Wortgebrauchs besteht darin, dass das Grundwort Tourismus in Verdrehung der offenkundigen Tatsachen eine dem Vergnügen und der Erholung dienende freiwillige Reisetätigkeit impliziert. Das Bestimmungswort sozial reduziert die damit gemeinte Zuwanderung auf das Ziel, vom deutschen Sozialsystem profitieren zu wollen, und stellt die Flucht vor Krieg und die Suche nach Schutz in den Hintergrund."
Platz 3 geht an an die "defensive Architektur". "Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Übertragung aus dem Englischen (defensive/hostile urban architecture). Im Deutschen ist der Ausdruck auch unter der Alternativbezeichnung Anti-Obdachlosen-Architektur bekannt. Bei dem Wort defensive Architektur handelt es sich um eine militaristische Metapher, die verwendet wird, um eine Bauweise zu bezeichnen, die sich gegen bestimmte, wehrlose Personengruppen (zumeist Menschen ohne festen Wohnsitz) im öffentlichen Raum richtet und deren Verweilen an einem Ort als unerwünscht betrachtet. Die Jury kritisiert die irreführende euphemistische Bezeichnung einer menschenverachtenden Bauweise, die gezielt marginalisierte Gruppen aus dem öffentlichen Raum verbannen möchte."
Topnews
Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder
Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher
Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
Aktuelles
Martin Guerre: Wahrheit und Trug – Natalie Zemon Davis’ faszinierende Analyse einer Rückkehr
Sonny Boy: Al Pacinos autobiografischer Wegweiser durch Filmkunst und Leben
Kleinhirn an alle: Otto Waalkes’ humoristische Biografie mit Tiefgang
Ich fürchte mich nicht: Wenn BookTok die Magie von „Shatter Me" entfesselt
Der Astronaut von Andy Weir – Überlebensdrama im All und technische Finesse
Gnadenlos: Das Lied vom Henker: Norman Mailers literarisches Verhör der amerikanischen Gewissensfrage

Im Schatten der Adirondacks: Liz Moores Thriller „Der Gott des Waldes“ im Gesellschaftscheck
Der Teufel von Chicago: Erik Larsons True-Crime-Opus über H. H. Holmes
Frankfurter Buchmesse 2025: Buchverkauf an allen Tagen erlaubt – Ticketshop geöffnet
Im Schatten des Zodiacs: Robert Graysmiths packende Spurensuche
Menschenjagd – Running Man von Stephen King: Hochoktane Satire zwischen Dystopie und Reality-Show
Die Vegetarierin von Han Kang – Provokantes Porträt von Körper und Rebellion
Wie Risse in der Erde: Schuld, Liebe & packender Dorset-Psychothriller
Kein Land für alte Männer von Cormac McCarthy – Gewalt, Schicksal & Moral im amerikanischen Grenzland
Very Bad Queen von J.S. Wonda – Finale der Kingston University / Very Bad-Serie
Rezensionen
Martin Guerre: Wahrheit und Trug – Natalie Zemon Davis’ faszinierende Analyse einer Rückkehr
Sonny Boy: Al Pacinos autobiografischer Wegweiser durch Filmkunst und Leben
Kleinhirn an alle: Otto Waalkes’ humoristische Biografie mit Tiefgang
Ich fürchte mich nicht: Wenn BookTok die Magie von „Shatter Me" entfesselt
Der Astronaut von Andy Weir – Überlebensdrama im All und technische Finesse
Gnadenlos: Das Lied vom Henker: Norman Mailers literarisches Verhör der amerikanischen Gewissensfrage